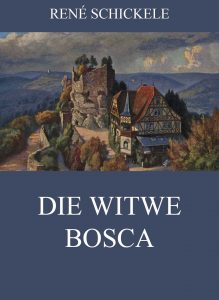Die Witwe Bosca – René Schickele
Die Witwe Bosca ist eine Anspielung auf das Weltbild der Nationalsozialisten und die darin verkörperte Idee des Bösen. Viele von Schickeles Werken sind durch die besondere Stellung des Elsass in der französischen und deutschen Kultur geprägt.
Format: eBook
Die Witwe Bosca.
ISBN eBook: 9783849657086.
Auszug aus dem Text:
Die Jahreszeiten der Provence wechseln leise in der Nacht.
Du siehst, du hörst sie nicht kommen. Eines Morgens wachst du auf und hast einen neuen Schatz …
Das Blühen findet kein Ende von Valence, dem Tor des Sonnenreiches, bis hinunter ans Meer, dem die hellen Götter entstiegen. Selbst in den kahlsten Monaten, November und Dezember, blühen immer noch Rosen, roter Centranthus und weißer Thymian an Rain und Fels, Geranien und Ringelblumen in den Garten, im Pinienwald das hohe Heidekraut, es blühen schon die frühen Mimosen, die Nelken. Die Blüten des Mispelbaumes sind unscheinbar, aber wenn dich plötzlich ein Duft einhüllt, süß und dicht, fast glaubst du, ihn mit Händen zu greifen, so ist es der Duft der Mispel – der leiseste Wind spült ihn über Hecken und Mauern.
In Trupps sprudeln die Blumen aus dem Boden, du gerätst in Düfte wie in überströmendes Quellwasser, das auf gut Glück seinen Weg sucht. Frauen sind dann einfach entzückt von solcher Liebeserklärung aus heiterem Himmel, wohingegen die Männer sich gewohnheitsmäßig nach dem Ursprung und Ausgangspunkt der Überrumpelung umsehen.
Nachts hängt der Sternenstaub in Wolken am Himmel, unruhig zucken die Fackeln der großen Gestirne. Du siehst: die Schöpfung ist nicht zu Ende, sie ruckt und gärt, ruhelos geht sie weiter. So ist es von Valence, dem Tor des Lichtreiches, bis hinunter ans Meer.
Es gibt einen Wind, der geht so leicht wie das Wehen von Schmetterlingsflügeln, kein Ast rührt sich, kein Halm, der Wind bewegt nur die Düfte.
Du hast ihn anderswo auch, es sind örtlich begrenzte Luftwirbel, die von der heißen Erde aufsteigen – ein Wind wie um eine Wiege. Aber nirgends nimmst du ihn mit solcher Dankbarkeit wahr wie hier, wo die Windorgel in voller Größe über dem Lande steht und oft genug ihr ganzes Register entfaltet.
In den Stunden des kleinen Windes träumt die Provence mit allen ihren Maisfeldern, Äckern und Rebgärten, ihren Weiden und Olivenwäldern den Traum eines Kindes, sie hat einen Ausdruck von rührender Sorglosigkeit. Über die Silberberge am Horizont rieselt ein dünnes Licht, und wenn du stillstehst, glaubst du im Himmel das Geräusch einer Sanduhr zu hören … “Die Engel schleichen zu ihren Liebsten”, sagt das Volk.
Als Paul klein war und mit seiner Mutter spazierenging, suchte er auf den Zehenspitzen sowohl nach den Engeln wie nach ihren Liebsten, aber er scheuchte höchstens ein Kaninchen auf.
“Sie hören den leisesten Schritt”, erklärte die Mutter, “und dann verstecken sie sich in den Zypressen.”
Paul bewunderte die schlauen Engel und haßte die Zypressen.
“Und wo sind die Liebsten?” fragte er.
Frau Pauline blickte sich verlegen um, und da sie auf der Erde keinen geeigneten Schlupfwinkel für die Liebsten der Engel ausfindig machen konnte, deutete sie auf eine Wolke, die einsam im blauen Himmel hing.
“Dort in der Wolke”, behauptete sie.
“Alle zusammen in einer Wolke?” fragte das Kind mit gerunzelter Stirn. “Und warum suchen die Engel so lange auf der Erde, wenn sie wissen, daß ihre Liebsten fliegen können?”
“Das ist es eben”, meinte Pauline, “sie wissen es nicht. Frauen, siehst du, mein Junge, Frauen sind immer noch schlauer. Ihre besten Eigenschaften verheimlichen sie. Während die Engel hier unten suchen, sitzen ihre Liebsten in der Wolke und lachen sie aus. Und wenn sie genug haben, fliegen sie herunter und tun so, als wären sie nie anderswo gewesen.”
Paul, der annahm, alle Liebsten, die himmlischen so gut wie die irdischen, glichen seiner Mutter, stellte sich vor, wie Frau Pauline in der Wolke hockte und ihn, der in den Furchen der Weinäcker nach ihr suchte, heimlich auslachte.
“Na ja”, sprach er einsichtsvoll, “warum nicht – wenn sie Ferngläser haben!” Auf dem Tisch der Mutter lag ein Fernglas, mit dem suchte sie bisweilen den Horizont nach Schiffen ab. “Aber weißt du, Mutter, wenn ich fliegen könnte – ich könnte es nicht für mich behalten.”
Inzwischen ist Paul zu einem achtzehnjährigen Jungen herangewachsen. Seinen Widerwillen gegen die Zypressen hat er behalten. Wenn er an Tagen des kleinen Windes mit seiner Mutter über Land fährt, nennt er sie gern ›Rabenbäume‹ und verlangt, nach Gebrauch sollten sie in der Versenkung verschwinden. Denn tatsächlich verdanken sie ihr häufiges Vorkommen in der Provence nicht der Liebhaberei der Bewohner. Sie sind nicht für das Auge da, sondern für den Mistral. Seinetwegen hat man sie in langen Reihen angepflanzt, sie sind die Windbrecher, die schwarzen Molen, hinter denen die Blumen- und Weingärten sich an sturmbewegten Tagen ducken.
Außerdem stehn sie hochmütig wie Pfaffen bei den Toten und schüchtern die Lebenden ein. Frau Pauline behauptet, sie hätten in ganz anderem Maße noch als Totengräber den ›bösen Blick‹, und man täte gut, sich rechtzeitig abzuwenden. Freilich, sie verabscheut alles Düstere, sogar das Halbdunkel der gegen die Sonne verschlossenen Zimmer, ohne das ein Leben in den heißesten Monaten kaum erträglich ist. Sie zieht es vor, im Notfall der Hitze mit ihrem kleinen, offenen Wagen zu entfliehen. “Wo kein Wind ist, mache ich ihn mir”, sagt sie. “Nur hell muß es sein.”
“Nur hell muß es sein”, sagt auch Paul. Aber damit meint er nicht nur das Licht. Das Wort ›hell‹ ist das Wort, das ihn am frühesten beeindruckte, er vermutet, es sei das Wort, das in seiner Kindheit am häufigsten vorkam. Es wohnt in ihm als das Maß der Dinge. Was er lebensfördernd und begehrenswert findet, das nennt er hell.
Mit dieser ihrer Veranlagung könnten Mutter und Sohn im Süden auf Schwierigkeiten stoßen, nicht zuletzt auf solche häuslicher Art. Glücklicherweise ist es dem unscheinbaren, blonden Wesen in weißer Küchenschürze, das Haus Rosmarin seit Jahren betreut, ganz gleich, ob die Zimmer über Mittag der Sonne geöffnet bleiben, ob Fenster und Türen schlagen und alles, was beweglich ist, stürmisch aufbricht, um dem großen Ruf des Windes zu folgen. Das Mädchen hat die Anpassung der Kreatur auf die Spitze getrieben. Es schmilzt in der Hitze, ohne die Arbeit zu unterbrechen, und gewinnt mit zunehmender Kühle seine Festigkeit zurück. Ursprünglich ein wildes, störrisches Bauernkind, ist ihr der Kopf frühzeitig zurechtgesetzt worden. Von wem? Sie würde gläubig antworten: vom Leben. Sie ahnt nicht, daß die vielberufene ›Erziehung durch das Leben‹, wie sie von den Stärkeren unter uns als Bevollmächtigten der Gemeinschaft geübt wird, lediglich die Summe ihres Eigennutzes darstellt. Für sie waren die richtungweisenden, nachhaltigen Ohrfeigen Äußerungen einer Vorsehung, deren Absichten sich erst dem erfahrenen, am Ziel angelangten Gemüt enthüllen.
Als nach Erwerb der Rosmarin durch Frau Pauline die einzige Zypresse im Garten fiel, sah das Hausmädchen der Gewalttat von fern wie der Austreibung des bösen Geistes zu, mit Neugier und Gruseln und einem feenhaften Lächeln – bereit, beim ersten Anzeichen einer Gefahr dorthin zu fliehen, wo es auf der Welt am sichersten war: in ihre Küche.
Sie wußte, warum. Zehnjährig hatte sie die Eltern verloren, an deren Grab stand eine Zypresse, die hatte an beiden Tagen, während der Sarg in der Grube versank, ganz entsetzlich um sich geschlagen, als wollte sie damit andeuten, daß mit dem Tode der Eltern die Prügel nicht aufhörten, Verfolgung und Züchtigung vielmehr auf weit gefährlichere Mächte übergingen. Das Mädchen war beide Male vom offenen Grab weggelaufen und allmählich in fremdem Dienst sanft und furchtsam geworden. Es hieß Marie-Luise, aber so sagte man im Haus Rosmarin nur, wenn es ernstlich Tadel verdiente, sonst rief man es ›Schäfchen‹.
Schäfchens Argwohn gegen die Zypressen ging auf schmerzliche Erfahrungen zurück und saß dementsprechend tief. Mutter und Sohn hingegen nährten ihre Abneigung, weil der glücklichste Mensch Feinde braucht, und wäre es nur, um seine Freunde auszuzeichnen. Da sie sonst alles an der provenzalischen Landschaft guthießen, blieb auch der im Grunde mehr scherzhaft verfolgte Popanz als Abstich und Gegenbild in ihre Liebe eingeschlossen. Das Angebot eines Gottes, das Land davon zu befreien, hätte sie nicht nur in Verlegenheit gebracht, es hätte sie entsetzt, sie wären in die Knie gesunken, um für die Erhaltung ihres Popanzes zu beten.
Das Fällen der Zypresse im Garten des Hauses Rosmarin hatte übrigens zur Folge, daß die Witwe Bosca, die dem Schauspiel auf der Veranda der Santa Maria beiwohnte, ganz unvermutet eine heftige Bewunderung für diese Bäume in sich entdeckte. “Es sind Soldaten”, sprach sie zu ihrer Tochter. “Stramm und verschwiegen. Aber undisziplinierte Naturen stoßen sich bereits an ihrer Haltung …” Schäfchen, das zufällig zur Veranda des Nachbarhauses hinüberblickte, fing einen Blick auf, unter dem sie zusammenzuckte wie unter einer zum Schlage erhobenen Hand. Aber sie verlor nicht ihr Lächeln – das Lächeln hielt sich wacker und verzog sich nur sekundenlang zu einer kleinen Grimasse.
….