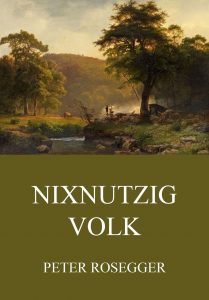Nixnutzig Volk.
Liebevoll erzählt der Walddichter Geschichten aus seiner ländlichen Heimat. Immer lustig, aber auch immer lehrreich. Peter Rosegger war ein österreichischer Schriftsteller und Poet, der 1918 in Krieglach verstorben ist.
Format: eBook.
Nixnutzig Volk.
ISBN: 9783849653088
Auszug aus dem ersten Kapitel:
Dann wurde ich Schauspieler. Unsere Gesellschaft war eine wandernde, weil man uns überall sehen wollte. Wo wir einmal waren, da mochten sie uns nicht fortlassen, bevor sich nicht jeder von uns förmlich losgekauft hatte. Mein schauspielerisches Talent war sehr groß, doch wollte es nicht recht heraus; zwischen Lunge und Leber mußte es sich verklemmt haben, denn wenn ich von der Leber weg sprechen wollte, versagte mir regelmäßig der Atem. Doch war ich der beliebteste der ganzen Truppe und rettete manches Stück. Man gab Ritterstücke und Tragödien. Aber die Leute wollen lachen. Ich hatte nämlich mehrmals die Rolle tragischer Helden bekommen, ich wollte sie gar nicht lustig spielen und sie wurde doch lustig. Das ist das Unbewußte – die Genialität. Der Alte war die ersteren Male verdrießlich über die, wie er sagte, unpassend erregte Heiterkeit, als aber dann das Haus zum Platzen voll ward, so oft ich in tragischen Rollen auftrat, erkannte er meine hinreißende Kraft und versprach mir, wenn ich auch das Zettelaustragen übernehmen wollte, eine Erhöhung der Gage. Wir sagten nicht »Gasche«, sondern Gage, wie sie geschrieben wird, nur wenn der Direktor manchmal aufgebracht war, denn der Mann litt an Jähzorn, verfiel er in den alten Fehler und nannte uns Bagasche, bis der rote Louisel ihm einmal höflich nahelegte, daß er doch keinen solchen Aufwand treiben solle, alldieweilen wir nur auf die zwei letzten Silben Anspruch machten. Denn die Gagen wurden nicht so regelmäßig zugestellt, wie die Rechnungen unseres Herbergsvaters.
Der rote Louisel – wegen seiner roten Gesichtsfarbe und des ziegelblonden Haares so geheißen – hatte allerhand Einfälle; er verfertigte Theaterstücke, neue, und besserte alte aus. Der Schiller und der Schekspier waren auf unserer Bühne nämlich nur möglich, wenn der Louisel die letzte Hand angelegt hatte. Aber er war komisch, dieser Louis Gruber; während er auf Befehl des Alten ganze Seiten streichen mußte, streckte er seine krumme Nase und sagte, das Feine siebe man durch, das Grobe, die Kleie, sei gut für die Säue. Der Louisel war ein gemütliches Haus und seiner geringen Begabung gemäß stets bescheiden. Er hatte etwas Geist und Gemüt, aber kein Taschenmesser. Wir beide tranken beim Wirt nie immer noch eins, wie die alten Deutschen, sondern immer nur eins. Und wenn es dann zum Zahlen kam, sagte der Louisel manchmal zu mir: »Tu’ mich auch gleich mit ab, Walter, du weißt, der Alte hat wieder einmal nicht gegagt. Bis er aber seine Gage erhielte, würde er für den ganzen Tisch zahlen. Einmal wurde er von uns andern daran erinnert; er antwortete, beim Wort bleiben zu wollen und für den ganzen Tisch zu zahlen – es war ein großer viereckiger Eichentisch – falls dieser etwas verzehre. Das waren aber nur faule Fische; wir Umsitzenden hatten uns, wenn er bei Taschenmesser war, nicht zu beklagen. Es verstand sich von selbst, daß für zwei solche Kerls, wie der rote Louisel und der Heldenspieler Walter, die Welt der Bretter zu enge werden mußte. Der Louisel hatte wieder einmal ein Stück geschrieben, und ich sollte einen meineidigen Bauern geben, der sehr fromme Reden im Mund führte, dabei seine Blutsverwandten betrog, dann bei einer Geistererscheinung sich bekreuzen will, aber die Hand nicht heben kann, mit der er einst den falschen Eid geschworen. Eine abscheulich langweilige Rolle. Ich hätte trotzdem daraus etwas gemacht, wenn der Dichter nicht darauf bestanden haben würde, mich spießgenau an den Text zu halten und nicht ein einziges Wort zu extemporieren. Die Herren selber können ja nichts, und schöpft man einmal aus dem eigenen Vollen, dann wird man »Batzenlippel« genannt, was soviel heißen soll, als eingebildeter Tropf. Das ist der Neid. Nun diesmal dachte ich gleich, daß sich diese kleinliche Prinzipienreiterei rächen würde. Wenn dem Schauspieler etwas Besseres einfällt, als der Souffleur weiß, warum nicht sagen! Daß geniale Menschen, die mit reicher Phantasie begabt sind, an Gedächtnisschwäche leiden, ist eine alte Erfahrung. Und da ein guter Schauspieler sich auf den Souffleur nicht verlassen soll, so war ich eben wieder ganz auf mein eigenes Ingenium angewiesen bei derselben Premiere. Der erste Akt ging vorzüglich, ich heuchelte flott drauf los, als bewegte ich mich allen Ernstes in der guten Gesellschaft, und schwur mit salbungsvollster Frömmigkeit den falschen Eid. Gegen Ende des Aktes jedoch, wie der Louisel als Geist erscheint, komme ich plötzlich aus der Fassung und kann nicht weiter. Der Geist zischelt mir Flüche zu, die gerade auch nicht im Buche stehen; das verehrungswürdige Publikum beginnt zu kichern, mir wird ganz blau vor den Augen, der Souffleur schreit mir den Text her, das macht mich erst recht irre. »Halt’s Maul!« rufe ich ihm zu, »laß dich einsalzen mitsamt deinem Büchel. Weiß es lang’ schon, was drinnen steht, besser als du!« Die Leute werden unruhig, da ich schon einmal entgleist und in meinem Fahrwasser bin, so trete ich vor und rede lustig ins Haus hinein: »Verehrungswürdige! Was sollen’s denn noch sitzen bleiben bei der Hitze! Den ganzen dritten Akt lang! Daß Sie’s nur wissen, der Meineidige hat halt ein böses Gewissen, und wenn er sich vor dem Geist bekreuzen will, kann er die Hand nicht heben, es trifft ihn der Schlag, er fällt zusammen und wird vom Teufel geholt. So – da habt ihr die ganze Geschicht’.« Der Vorhang fällt, aber – weil ich zu weit vorn am Rande stehe – zum Glück hinter mir, so daß er mich von den hinten drohenden Mächten trennt, hingegen dem rasenden Publikum aussetzt. Das rast, aber vor Vergnügen, und wer das nicht miterlebt hat, weiß nicht, was Applaus ist. Von der vordersten Reihe herauf wird mir der Riesenblumenstrauß gereicht, der dem Autor des Stückes bestimmt gewesen. Ich sage noch tiefgefühlte Worte unaussprechlichen Dankes im Namen des Dichters, da höre ich rufen: »Selber behalten! Selber essen!« Das dämpfte etwas, für was halten sie mich denn, daß ich Blumen essen soll!
Das Ende ist zu erraten. Das Stück hatte keins an diesem Abend, die Wurst hatte zwei und das meinige schien gekommen zu sein. Klipp und klar zerreißen wollten sie mich. Der Direktor wollte gar nicht aufhören, mir Backenstreiche zu versetzen, rechts und links, so daß vor meinen Augen allemal die Funken stoben. Umgekehrt, wie bei einem Gewitter, wo zuerst der Blitz und dann der Schlag erfolgt. Der Louisel war halb gebrochen hinter einer Kulisse gesessen, aber nun, da es galt, einen Mord zu verhindern, eilte er herbei, um mich aus den Händen des Tyrannen zu befreien. Jene aber, die sich mit meinem Blumenstrauß befaßt, brachen plötzlich in ein mächtiges Spektakel aus, sie hatten darin, verborgen wie eine Schlange unter Rosen, eine riesengroße Leberwurst entdeckt. Diese sensationelle Entdeckung änderte – wie das schon oft so vorkam – den Lauf der Geschichte. »Volkes Stimme ist Gottes Stimme!« deklamierte der Alte – er hatte keinen übeln Baß – »und wenn’s dem Publikum recht ist, so kann’s uns um so lieber sein.« Wir zogen uns in das Theaterrestaurant, zum Schöpsenwirt, wo unser Logement war, zurück, und der Direktor hat zur Wurst das Bier gezahlt.
Nach solchem Erfolge – der weder dem Zufall, noch dem Talente, sondern einzig nur dem Ingenium zuzuschreiben war – litt es mich natürlich nicht mehr länger bei der Schmiere. Ich wollte mich bloß einmal im Burgtheater engagieren lassen, vorher aber eine Kunstreise durch Amerika machen, denn später bekommen erste Kräfte für derlei Seitensprünge keinen Urlaub mehr.
Aber nun spreche ich aus schlimmer Erfahrung. Keinem Kollegen von der Kunst möchte ich raten, so aus dem Stegreif zu reisen. Man extemporiert wohl auf der Bühne, aber nicht nach Amerika. Das muß gut memoriert sein und für den Mimen ist der Impresario noch weit wichtiger, als der Souffleur. Ich kam natürlich gar nicht hinüber. In Bremerhaven haben sie mich zurückgewiesen; sie ahnten in mir einen Defraudeur und ahnten recht. Wollte ich nicht das größte, mindestens zweitgrößte Genie Europas nach der Neuen Welt hinüberlotsen? Auf der Rückreise wandte ich mich wiederholt an Mäcene, wovon die meisten Zwei-, andere auch Fünf-, einige sogar Zehnpfennigstücke gaben. Ich sah nun, daß meine Ruhmesbahn starke Krümmungen hatte. Eine davon führte mich aufs Schloß, wobei ich den Vorteil, der in einem einstweiligen Berufswechsel lag, sofort erkannte. Ablenkende Nebenumstände bleiben unberührt; es sei vor allem kurz angemerkt, daß ich mir auf jenem Landschlosse einen Herrn aufgenommen habe. ….