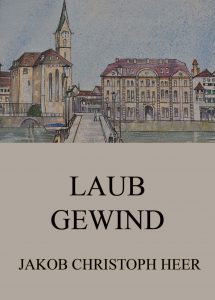Laubgewind – Jakob Christoph Heer
In “Laubgewind”, einem Künstlerroman, der in München um 1900 spielt, erzählt der Schweizer Schriftstellers die Geschichte seiner Landsfrau Hilde Rebstein, die immer wieder wechselnden Einflüssen unterliegt und damit irgendwann nicht mehr klar kommt.
Format: eBook
Laubgewind.
ISBN eBook: 9783849655846.
Auszug aus dem Text:
Es war um die Mittagszeit. Der Herbststurm strich durch München. Die breite, schöne Ludwigstraße lag in greller Sonne. Die Menschen eilten und hasteten wie jeden Tag um diese Stunde.
Auch sie eilte und hastete.
Nein, auf dem Odeonsplatz, am Eingang der Straße stand sie vor einer Kunsthandlung mit großen Auslagen still. Seit sie in München weilte, war es ihr zur Gewohnheit geworden, auf dem Weg zum Mittagsbrot einen kürzeren oder längeren Blick auf die wechselnden Schätze des Kunstladens zu werfen. Der Sturm drängte sie fast mit Gewalt zum Weitergehen, sie aber stand. Das wilde Spiel des Windes tat ihr nach den langen Vormittagsstunden im schlecht gelüfteten, überheizten Atelier wohl. Sie freute sich, daß es stürmte. Nur jetzt nicht die Ruhe!
Sie griff mit der Hand unwillkürlich in die Tasche ihres eisgrauen, wollenen Mantels. Der Brief aus der Heimat quälte sie, der Brief des alten Lehrers, der ihr kleines Vermögen verwaltete.
Um ihren Mund zuckte es von bitterem Ernst.
Was der alte, ihr wohlgesinnte Mann daheim im Dorf für ein gutes Gedächtnis besaß! Ja, gerade heute jährte es sich zum drittenmal, daß sie als Kunstschülerin nach München gekommen war. Grenzenlos schüchtern und fremd hatte sie damals die Stadt betreten, unter dem Trauerkleid aber, das sie zum Gedächtnis ihres kurz vorher verstorbenen Vaters trug, hatte ihr das neunzehnjährige Herz gesungen und geklungen von Liedern der Lebenserwartung. Da war sie zum erstenmal vor diesen Fenstern, vor diesen Auslagen mit heimlich jubelnder Seele gestanden. Von den Künstlern, die da drin ihre Zeichnungen, Aquarelle, Ölgemälde und kleine Bildhauerwerke ausgestellt hatten, waren gewiß manche ebenso fremd und ärmer als sie nach München gekommen. Nun glänzten ihre Bilder und Namen. Also gab es einen Weg zur Kunst, zur heiligen Kunst! Auch sie würde ihn finden, sie in ihrer treuen und eifrigen Hingabe, in ihrer glühenden Begeisterung für die Malerei. Sie besaß ja das schöne, vom Vater ererbte Talent, und auf ihren Plänen ruhte der Glaube, der Segen des zu früh Geschiedenen.
In München gab es so manchen hervorragenden Lehrer. Einem von ihnen, der eine Privatmalschule für junge Damen führte, war sie empfohlen. Zwei Jahre leidenschaftlich ernsten Studiums bei ihm – dann ständen ihre Skizzen und Bilder wie die anderer junger Künstler in den Auslagen, bescheiden erst und zu geringem Preis, aber doch mit ihrem Namen: Hilde Rebstein. Anfangs nur leise und obenhin, später mit Wohlwollen und Achtung sprächen die Bilderliebhaber und Kunstfreunde von dem jungen Talent. Und aus der großen Stadt klänge ihr Name bis in die ferne, liebe Schweizerheimat, bis nach St. Agathen, dem Ort ihrer Kindheit. Und die sie dort hatten aufwachsen sehen, sprächen: ›Ja, Hilde Rebstein, unsere hoffnungsvolle Künstlerin in München!‹ – Und der Glaube ihres künstlerisch veranlagten Vaters wäre gerechtfertigt!
Das war ihr Traum, ihr Ehrgeiz bei ihrer Ankunft in München gewesen. Heute vor drei Jahren! –
Hilde spann den Faden ihrer Erinnerungen nicht weiter. Die Gegenwart, die Lebenswirklichkeit stach zu scharf und weh von den jugendlichen Einbildungen ab, die sie damals in ihre Kunstschülerschaft geleitet hatten. Nicht zwei, nein, schon drei Jahre war sie jetzt eine von den vielen hundert unbekannten und namenlosen Malschülerinnen der Stadt, die Morgen um Morgen auf eine Offenbarung hoffend in ihre Klassen eilen und Abend um Abend enttäuschter und müder hinauf in ihre Mietzimmer steigen. Nie hatte sie eine Skizze, nie ein Bild in den Schaufenstern einer Kunsthandlung oder sonst auf einer kleinen Ausstellung gehabt. Sie hatte selbst den Versuch dazu nie gewagt und war durch die Erfahrungen der drei Jahre zu kleinmütig und zaghaft geworden, als daß sie sich nur mehr getraut hätte, daran zu denken. Der fromme Glaube an ihre künstlerische Berufung war in ihr vollkommen erschüttert.
Was sie schuf, war gewiß nicht talentlos, das hatte noch kein Lehrer und keine ihrer Mitschülerinnen behauptet, aber es war bei manchen Zeichen künstlerischer Ausdrucksfähigkeit doch unreif. Das gab sie selber zu. In ihrem Wesen lagen eigenartige Hemmungen des Talentes, die zu überwinden sie sich qualvoll mühte, und das schmerzliche Schwanken zwischen Können und Nichtkönnen hatte sie und ihren derzeitigen Lehrer, Professor Waldhier, in eine stille Spannung gebracht. Er, der sie vor einem Jahr mit hoffnungsvoller Freude aufgenommen hatte, setzte jetzt sogar Zweifel in ihren guten Willen.
Was ist es Seltsames und unheimlich Geheimnisvolles um die Kunst! Wie ein Lied voll heiliger Sehnsucht kommt der Schaffensdrang der hohen Stunde über die Seele. In wunderbarem Klarlicht lockt uns eine frühlinghafte Gestalt wie Liebe, verheißende Liebe. Aus einem Überschuß innerer Kraft erheben wir die Seele und die Hände zu dem göttlichen Gebilde. Es ist unser! – Nein, wie durch ein höllisches Wunder zerfließt die schöne Gestalt in dem Augenblick, da wir sie fassen wollen. Unsere Arme erzittern, erschlaffen und sinken, und die Hände können nicht wiedergeben, was das innere Auge in Qffenbarungswonnen sah. Nur ein Wechselbalg jener Gestalt, die unsere Phantasie mit seligen Schönheitsempfindungen erfüllte, liegt das Werk vor uns, eine Mißgeburt, die lebt und doch nicht lebt und unsere Seele laut aufweinen läßt, bis wir die Arbeit in vernichtender Enttäuschung von uns stoßen. –
Das ist das brennende Weh der Kunst: den gewaltigen Schaffens- und Gestaltungsdrang in sich spüren und doch nicht schaffen und gestalten können, wonach die Seele schreit.
Zu traurig! Daran mag jetzt Hilde nicht denken. Ihre Blicke hangen an einem Porträt: der junge Goethe! Es ist ein schöner und billiger Abdruck des Bildes von Kraus. Und sie liebt Goethe, vor allem den jungen Goethe! Ein Seufzer – nein, sie kann jetzt die Radierung nicht kaufen. Sie wird wohl zu Weihnachten noch zu haben sein. Zu Weihnachten! Vielleicht muß sie auch dann auf das Bild verzichten. Hardmeyer, der alte Lehrer in der Heimat, der ehemalige Freund ihres Vaters, schreibt ihr, daß er ihr von jetzt an nur noch fünfundsiebzig Franken im Monat zuwenden könne. Auch ohne Notenausgaben würde leider ihr kleines Kapital zu Ostern völlig aufgezehrt und sie in der zwingenden Lage sein, möglichst rasch auf eigenen Verdienst zu denken.
Oh, das sah sie klar, in dieser Lage war sie jetzt schon. Dreißig Mark das Klassengeld, zwanzig Mark das Zimmer – mit zehn Mark Pension und Kleider bestreiten? Unmöglich! Das war eine einfache Rechnung.
Sie trennte sich tief nachdenklich von dem Kunstladen. Doch nein, jetzt wollte sie nicht nachdenklich erscheinen. Bekannte, die ihr etwa begegneten, sollten ihr den Kummer nicht vom Gesichte lesen können.
Die weiße Wollmütze auf dem reichen dunkelblonden Haar, Hals und Brustansatz den Winden frei, die Hände etwas burschikos in den Mantel gesteckt, kämpfte sie tapfer und elastisch gegen den vom Siegestor herfegenden Sturm. Scharen von Studenten traten, ihre Bücher und Hefte unter dem Arm, aus den Lehrgebäuden an der Ludwigstraße. Sie begegnete manchem indiskreten Blick, denn der Sturm, der ihr Mantel und Kleid fast vom Leibe riß, ließ ihre schlankkräftigen Glieder mehr als sonst aus der Gewandung hervortreten.
Damals vor drei Jahren, als sie aus der Heimat nach München gekommen war und sich erst an das Stadtleben gewöhnen mußte, hatte sie über neugierige Blicke noch erröten und sich kränken können, in einer großen Stadt aber verlernt man das bald und lernt dafür das Übersehen und Überhören – sie fühlte sich als die selbständig vor das Leben gestellte junge Dame, die ihren Schutz gegen Zumutungen und Anmaßungen in sich selber trägt.
Ob sie Kuno Glür unter den Studenten entdeckte? Nicht, daß ihr stark daran gelegen wäre. Im Grunde war ihr die Erscheinung des Fabrikantensohnes aus der Heimat, eines schon ältlichen Hochschülers, der die Kollegien nur unregelmäßig besuchte, nicht besonders angenehm, aber die Herkunft aus dem nämlichen Dorf bildete doch ein gewisses Band zwischen ihnen. Sich von Zeit zu Zeit zu begegnen, war schon deshalb hübsch, weil man ein paar Worte gegenseitiger Erkundigung im altlieben Heimatdeutsch miteinander wechseln konnte. Und das Heimatdeutsch klang hier in der Ferne so – so traulich und lieb! Selbst von Kuno Glürs aufgeworfenen Lippen.
Er war nicht unter den Studenten. Richtig, er hatte ihr ja schon vor Wochen erzählt, daß er Ende Oktober daheim in St. Agathen den Hochzeitsfeierlichkeiten seiner Schwester Lili beiwohnen werde. Dort mochte er jetzt sein, der Glückliche! Wann sieht wohl sie wieder einmal die Heimat – und Adolf, ihren lieben Bruder?
Früher hatte sie mehrere Bekannte unter den Studierenden der Universität besessen, mit Ausnahme Kuno Glürs aber hatten sie München wohl mit anderen Städten vertauscht, und sie – sie machte auch nicht mehr die Besuche in den Familien, in denen sie die jungen Leute kennenlernte. So einsam wie jetzt hatte sie in München noch nie gelebt. Kein Freund, keine Freundin! Das lag an ihr selbst. Ja, wenn sie nur ein wenig auf einen künstlerischen Erfolg hätte blicken können, wie sie ihn sich vor drei Jahren erträumt hatte! Da brächte auch sie den Menschen ein offenes, lachendes Wesen entgegen, Mißerfolg und Enttäuschung aber lassen die Seele verstummen. Sie trennen von den Menschen. Nur nicht sonniges Wohlergehen in der Gesellschaft heucheln, wenn das Herz aufschreien möchte vor innerer Qual!
…..