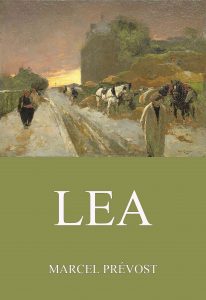Lea – Marcel Prévost
In “Lea” knüpft Prévost an die Geschichte aus “Frederique” an und führt die Geschiche der zwei gleichnamigen Schwestern weiter. Er beschreibt den Kampf um Anerkennung, Gleichberechtigung und Arbeit in einem von Vorurteilen geprägten Frankreich.
Format: eBook
Lea.
ISBN eBook: 9783849656874.
Auszug aus dem Text:
Wie jede große Hauptstadt, besteht auch Paris eigentlich aus mehreren Städten. Besonders, wenn man von Westen kommt, stößt man auf Vororte, die streng genommen noch zu Paris gehören, dabei aber den Eindruck von kleinen Provinzhauptstädten machen – so z. B. Neuilly und Levallois. Wenn ein Fremder sich etwa einen Tag im Faubourg St. Charles, – der unmittelbar an das Stadtquartier Javel anstößt, – aufhielte und dann direkt in seine Heimat zurückkehrte, so würde er sich wahrscheinlich einen seltsamen Begriff von Paris machen. Und doch hat er einen Teil der Hauptstadt kennen gelernt, der in etwa zehn Jahren, wenn die alten Festungswälle einmal gefallen sind, ganz mit ihr verschmolzen sein wird.
St. Charles nimmt den viereckigen Raum zwischen dem linken Seineufer und der Ringbahn ein. Die Hauptverkehrsader ist die rue St. Charles, die Javel der ganzen Länge nach durchschneidet. In dieser Straße machen die Bewohner ihre täglichen Einkäufe. Wenn die bescheidenen Vorräte des Kaufladens das Gewünschte nicht enthalten, so heißt es: “O, das können wir uns aus Paris kommen lassen.” Ebenso pflegt der Bewohner von St. Charles am Morgen seiner Frau zu sagen: “Ich komme heute nicht zum Frühstück. Ich muß nach Paris.”
Man muß hier, wie in den Städten Nordamerikas, zwischen den angestammten Ureinwohnern und den Eingewanderten unterscheiden. St. Charles war ursprünglich ein Dorf, das noch unter Ludwig XVI. ganz unbekannt war. Die Bewohner waren einfache Landleute, von denen mancher den Louvre niemals zu sehen bekommen hat. Von diesen Ureinwohnern existieren noch einige Familien, unter denen die Namen Froment, Martin und Bahuchet häufig wiederkehren. Es sind fast alles kleine Kaufleute: Kurzwarenhändler, Krämer, Bäcker u.s.w. Keine einzige von diesen Familien gilt für reich, die Groß-Industriellen, die St. Charles kolonisiert haben, waren im allgemeinen Pariser aus dem Centrum von Paris und sind es auch geblieben. Die Roussins, deren Petroleumraffinerie in der rue de Loruel liegt, haben ihr Hotel am Park Monceau; der Verleger Verdier wohnt am Trocadéro. Jude Duramberty, der große Tapetenfabrikant, hat seine Fabrik in der rue de Bergers, aber gleichzeitig besitzt er eine luxuriös ausgestattete Wohnung in der rue François-Premier. Und all diese Fabrikanten gehen Tag für Tag nach St. Charles, wie der englische Kaufmann zur City geht. Es kommt keinem von ihnen in den Sinn, dort zu wohnen.
Übrigens sind all diese Etablissements nicht ohne bedeutenden Einfluß auf die Bevölkerung geblieben; sie haben die Zahl derselben vermehrt und ihr zwei neue Elemente zugeführt: den Beamten und den Arbeiter. Das einstige Dorf St. Charles zählt heute mehr als 20 000 Seelen, also ebensoviel wie Chartres. Die Beamten der großen Fabriken wohnen fast alle im Ort. Einige logieren im Fabrikgebäude, die andern mieten sich in seiner Nähe ein. Die Arbeiter dagegen, für die das Centrum von St. Charles bald zu kostspielig geworden ist, wohnen in den äußeren Straßen der Vorstadt. Das Gesamtbild von St. Charles könnte man also ungefähr so charakterisieren: ein Stamm von eingeborenen Kleinkaufleuten und Subalternbeamten; eine Arbeiterbevölkerung, die jenem Stamm an Zahl überlegen ist, und schließlich einige Großkapitalisten, denen fast der ganze Ort gehört, die aber sämtlich in Paris wohnen.
Man kann sich leicht vorstellen, was die Folgen dieser Zusammensetzung sind: Arbeiter und Bourgeoisie liegen einander beständig wegen aller möglichen rein lokalen Fragen in den Haaren; der ausschlaggebende Einfluß in politischen Angelegenheiten geht jedoch, wie überall, von den Kapitalisten aus, das heißt also, von Leuten, die nicht einmal ihren Wohnsitz im Orte haben.
Dieser Einfluß macht sich übrigens nur dann und wann einmal geltend, wenn z.B. einer von den Großindustriellen das Bedürfnis fühlt, sich in St. Charles eine politische Stellung zu schaffen. Aber für gewöhnlich wird die Politik des Ortes von den wirklichen Einwohnern, – den Angestammten oder Zugewanderten – gemacht. Und so findet man hier, wie in jeder französischen Provinz, die Spaltung in eine Regierungs- und eine liberale Partei. Da nun keine eigentliche Aristokratie vorhanden ist, repräsentieren die eingeborenen Kaufleute im Verein mit einigen Rentiers die Regierungs- oder, wenn man so sagen will, die reaktionäre Partei, zu der selbstverständlich auch die pensionierten Bureaubeamten gehören. Wer zwanzig oder dreißig Jahre lang in einer Provinzialstadt lebt, hat gewöhnlich weder die Lust noch die Mittel, seinen Wohnort zu verlassen und nach Paris zu ziehen. So geht es auch den Bewohnern von St. Charles, wenn sie in den Ruhestand treten. Sie pflegen sich dann ein Häuschen mit einem kleinen Garten zu mieten, am liebsten an den Festungswällen, wo sie sich dann mit ihrer Familie einrichten. Ihre einzigen Zerstreuungen bestehen darin, an den Ufern der Seine spazieren zu gehen, den Militärübungen zuzuschauen, dann und wann das Theater von Grenelle oder irgend einem Jahrmarkt und alle zehn Jahre vielleicht einmal die Ausstellung zu besuchen.
Natürlich sind sie reaktionär, wie alle französischen Rentiers, weil sie für die Sicherheit ihres Besitzes fürchten. Denn Tag für Tag sehen sie das Gespenst der Revolution vor sich vorüberziehen. Wenn die Fabrikglocken ertönen, stehen die alten Rentiers am Fenster ihrer Gartenhäuschen, um mit geheimen Schrecken diese unheimliche Armee des Elends, des Hungers und der harten Arbeit vorbeidefilieren zu sehen. Und dann rufen sie ihre Frauen und sagen: “Da – die Anarchisten!” Aber ihre Furcht ist überflüssig. Die Arbeiterpartei würde in St. Charles, wie in allen Industriestädten, die stärkere sein, wenn sie nicht zu ungebildet, zu gutmütig und zu beschränkt wäre. – Es gab eine Zeit, etwa von 1880 bis 1886, wo sie unter der Leitung eines ehrgeizigen Führers eine feste Organisation bildete, aber nach seinem Tode spaltete sich die Partei, die Reaktionären wußten diese Spaltung zu befördern und auszunutzen: die Arbeiterpartei verbündete sich mit den Reaktionären, um den damaligen Gemeinderat zu stürzen und ihn durch ein bunt zusammengewürfeltes Gemisch von regierungsfreundlichen und extremsocialistischen Elementen zu ersetzen. Diese seltsame Zusammenstellung hielt sich drei Jahre lang, wurde dann wieder durch eine diesmal socialistisch-radikale verdrängt, aber bei den Gemeindewahlen von 1896 errang sie von neuem einen vollständigen und diesmal auch andauernden Sieg. Es wurde diesmal ein Programm aufgestellt, dessen Hauptartikel wir hier erwähnen müssen. Er bezog sich auf die gleiche Verteilung der Bezirksschulgelder unter die freien und konfessionellen Schulen Dieses Übereinkommen zwischen den Socialisten und den Klerikalen nannte man den “Vertrag von St. Charles.”
So kam es, daß im Jahre 1898, am Vorabend der großen Ausstellung, die das Jahrhundert beschließen sollte, der kleine Industrieort St. Charles von einem quasi socialistischen Gemeinderat regiert wurde. Die Spitzen der Behörden waren: Bürgermeister Anquetin, einstiger Werkmeister in der Fabrik Roussin, und seine Beigeordneten, ein Geschäftsagent, Namens Quignonnet, der hauptsächlich mit den zahlreichen, religiösen Stiftungen – Schulen oder Krankenhäusern der Stadt – zu thun hatte, und Duvert, der Direktor einer ziemlich schlecht gehenden Tapetenfabrik, die er sehr gerne an Duramberty verkauft hätte. Quignonnet, der Agent, war die Mittelsperson zwischen dem Gemeinderat und dem Klerus. Seine politischen Ansichten hätte wohl niemand recht zu definieren gewußt: er vermied es geschickt, sich darüber auszusprechen. Anquetin, ein finsterer, ehrgeiziger Mann, träumte davon, Nachfolger des Deputierten Ranblart zu werden, der zu Schlaganfallen neigte. Was Duvert anbetraf, so behaupteten seine Gegner, er sei bloßer Strohmann für die politischen Pläne Durambertys. Anquetin, Duvert und ihre ganze Partei gingen Hand in Hand mit den streng Klerikalen: Aiglon, der aus einer alten Juristenfamilie stammte, Monsieur de Lesparre, Kavallerieoberst a. D., dem Abbé Minot, erstem Pfarrer an der Kirche von St. Charles, und dem gesamten Kleinbürgertum. Duramberty wurde zur Partei Anquetins gerechnet, aber seine einflußreiche Stellung und sein großes Vermögen trugen ihm gleichzeitig die Sympathien der Kirche ein. Er hatte verschiedentlich bedeutende Summen für die freien Schulen gestiftet. In solchen Fällen pflegte er sich übrigens gewissermaßen dadurch zu decken, daß er die konfessionellen Schulen noch reichlicher bedachte. In Anbetracht seiner Freigebigkeit sah man es ihm gerne nach, daß er nie einen Fuß in die Kirche setzte.
Die Kirche wird in St. Charles außer der Pfarrei durch eine bedeutende Anzahl von Kapellen, Klöstern und religiösen Stiftungen repräsentiert, so das Kloster der Dames du Calvaire – die Redemptoristenkapelle, das Kinderhospital – die Dames du Saint-Sang. All diese katholischen Anstalten blieben jedoch unabhängig von einander und standen in politischer Hinsicht ziemlich isoliert da, bis der Abbé Minot erster Pfarrer von St. Charles wurde. –
Die Person dieses Priesters müssen wir etwas näher ins Auge fassen. Er war 1862 geboren. Seine Eltern waren einfache Landleute, die ihn schon früh für den geistlichen Stand bestimmt hatten. Seine schwarzen, struppigen Haare, seine großen, plumpen Hände und Füße verrieten die bäuerische Herkunft, deren er sich übrigens mit Vorliebe zu rühmen pflegte. Aber trotz diesem Mangel an äußeren Vorzügen und zugleich an hervorragender Begabung übte er auf seine Beichtkinder, auf seine Kollegen, und sogar auf manche seiner Vorgesetzten eine gewisse Autorität aus, da er ein Mann von ungewöhnlich festem Willen und strengen Sitten war. Man fühlte eben, daß er nie in seinem eigenen Interesse handelte und keinen persönlichen Ehrgeiz kannte, aber stets bereit war, alles zu dulden und alles zu wagen, was der Kirche zum Vorteil gereichen konnte.
Im Laufe des Jahres 189? wurde ein ziemlich großer Bauplatz, der Duramberty gehörte und direkt an seine Fabrik anstieß, von einer gewissen Mlle. de Sainte-Parade angekauft, um eine weibliche Gewerbeschule zu gründen. Das Unternehmen erregte allgemeines Aufsehen Es war einer der ersten praktischen Versuche, die von der Frauenbewegung ausgingen, und stellte sich schon dadurch von vornherein in Gegensatz zu den zahlreichen anderen Schulen von St. Charles. Mlle, de Sainte-Parade umgab sich mit einer Art von weiblichem “Generalstab”, der ohne jeden männlichen Beistand den Ankauf des Terrains in Scene setzte, den Bau überwachte und die Schule organisierte. Dieser sogenannte Generalstab bestand übrigens nicht etwa aus lauter alten, häßlichen, komischen Persönlichkeiten, wie man es sonst den Anfängerinnen der Emanzipation häufig nachzusagen pflegt. Unter den Damen, die der Gründerin hilfreich zur Seite standen, waren manche sogar von sehr angenehmem Äußeren: so z.B. Mlle. Heurteau, die früher staatlich angestellte Lehrerin gewesen war; die beiden “kleinen Sûriers” Lea und Friederike, zwei Schwestern im Alter von 19 und 26 Jahren, die sogar auffallend schön waren. Friederike, die ältere, eine hochgewachsene Brünette mit dunklen Augen und edel geschnittenen Zügen, und Lea, eine zarte, liebreizende Erscheinung mit ihren blauen Augensternen und den licht kastanienbraunen Locken. – Zu den “Hübschen” gehörten ferner noch Duyvecke Hespel, eine üppige Holländerin mit flachsblondem Haar, und Geneviève Soubize, – approbierte Hebamme – deren pikante Häßlichkeit und lebhafte Bewegungen die Blicke der Männer auf sich zogen. Die anderen wurden kurzweg die Scheusäler genannt. Zu diesen gehörten in erster Linie Mlle. de Sainte-Parade selbst, mit ihrem gelähmten, verkrüppelten Körper und dem unförmlich großen Kopf, und Daisy Craggs, eine etwa vierzigjährige Irländerin. Schließlich war da noch eine Persönlichkeit, die das meiste Interesse erregte und weder zu den “Hübschen” noch zu den “Scheusälern” gezählt wurde.
Es war eine kleine, schmächtige, kränklich aussehende Gestalt mit dünnem schwarzem Haar und dunkelblauen Augen, deren Blick eine seltsame magnetische Kraft inne zu wohnen schien. Sie trug einen fremdklingenden Namen: Romaine Pirnitz und galt für diejenige, deren geistiger Einfluß die Triebfeder des ganzen Unternehmens war, obgleich sie niemals offiziell in den Vordergrund trat. Nur bei der Einweihung der Schule hatte sie das Programm ihrer neuen Erziehungsmethode in einer längeren Rede dargelegt. In klaren, schlichten Worten, aber mit hinreißender Beredsamkeit setzte sie dem versammelten Publikum, das zum großen Teil aus Journalisten, Politikern und Mitgliedern der ersten Gesellschaft bestand, auseinander: es handle sich nicht nur darum, den jungen Mädchen aus dem Volk Orthographie, Rechnen, Nähen und kunstgewerbliches Zeichnen zu lehren, sondern darum, die moralische Erziehung der Frau durch die Frau zu begründen; eine Schule für junge Mädchen zu schaffen, wo diese zu wahrhaft moralischen Persönlichkeiten herangebildet werden sollten, eine Schule, wo sie gelehrt würden, sich ihr Brot selbst, ohne Hilfe der Männer, zu verdienen. – Alle diese Ideen wurden mit einer solchen Klarheit und überzeugenden Wärme vorgetragen, daß sie den Zuhörern durchaus nicht sonderbar oder widersinnig, sondern im Gegenteil ganz selbstverständlich und einleuchtend vorkamen. Und trotz ihres bescheidenen Auftretens galt Romaine Pirnitz von diesem Tage an für die geistige Urheberin und die Seele des ganzen Unternehmens. Die offizielle Leitung lag in den Händen von Mlle. Heurteau, der Friederike Sûrier als Beistand zur Seite gegeben war. Was Mlle. de Sainte-Parade betraf, so behauptete Duramberty, mit dem sie wegen des Bauplatzes persönlich unterhandelt hatte, sie sei eine halbverrückte alte Jungfer, die sich abwechselnd durch die Geistlichkeit, durch ihre Geschäftsagenten und durch die überspannten Anhängerinnen der Emanzipation beeinflußen ließe.
Der Ankauf des Grundstücks war unter ziemlich ungewöhnlichen Bedingungen abgeschlossen worden. Duramberty hatte – wie er sagte, um das hochherzige Werk zu unterstützen, – keine direkte Zahlung verlangt. Die Schule hatte innerhalb der nächsten zwanzig Jahre keinen Mietzins zu entrichten. Wenn sie nach Ablauf dieser Zeit noch existierte, sollte sie dann eine den Ortsverhältnissen entsprechende Summe für das Terrain erlegen, ohne den Besitzer desselben für die zwanzigjährige Nutznießung zu entschädigen. Wenn das Unternehmen jedoch aus irgend einem Grunde scheitern sollte, so würde Duramberty die volle Verfügung über sein Grundstück und alle darauf errichteten Gebäude wieder erhalten. Um ihm eine gewisse Garantie zu bieten, mußte die Administration der Schule bei der französischen Bank eine Kaution von 300 000 Franken hinterlegen, deren Zinsen ihr jedoch unverkürzt ausgezahlt wurden.
….