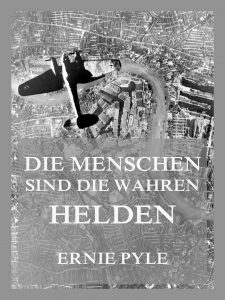Die Menschen sind die wahren Helden – Ernie Pyle.
Ernest Taylor Pyle (3. August 1900 – 18. April 1945), überall als “Ernie” bekannt, war ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter amerikanischer Journalist und Kriegsberichterstatter, der vor allem für seine Geschichten über einfache amerikanische Soldaten während des Zweiten Weltkriegs bekannt ist. Als die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintraten, verlieh er seinen Kriegsberichten aus dem europäischen (1942-44) und pazifischen Raum (1945) den gleichen unverwechselbaren, volkstümlichen Stil wie seinen sonstigen alltäglichen Geschichten. Im Dezember 1940 meldete sich Pyle freiwillig nach London, um über die Schlacht um Großbritannien zu berichten. Er wurde Zeuge der deutschen Brandbombenangriffe auf die Stadt und berichtete über den wachsenden Konflikt in Europa. Seine Erinnerungen an die Erlebnisse dieser Zeit wurden in seinem Buch “Die Menschen sind die wahren Helden” (im Original “Ernie Pyle in England”) veröffentlicht.
Format: Taschenbuch/eBook
Die Menschen sind die wahren Helden.
ISBN Taschenbuch: 9783849665418
ISBN eBook: 9783849662820
Auszug aus dem Text:
England, Dezember 1940
In unserem Hotelzimmer in Lissabon klingelte das Telefon, und man sagte uns, wir sollten heute Morgen noch vor Tagesanbruch am Flughafen sein. Nun glaube man aber nicht, dass ich deswegen in helle Aufregung verfiel. Unsere fast zwei Wochen des Wartens neigten sich dem Ende zu, und Lait und ich beschlossen, sicherheitshalber nicht einmal ins Bett zu gehen.
Jeder von uns ließ einen kleinen Koffer in Lissabon zurück, und um das Gewicht zu reduzieren, packte ich meine überflüssigen Sachen in einen weißen Zuckersack, den mir ein Schiffssteward gegeben hatte. Und so kam ich heute in England mit einer kleinen gelben Tasche, einer Schreibmaschine und einem zugeknoteten Zuckersack über der Schulter an.
Es war kalt und unheimlich in dem schwach beleuchteten Flughafengebäude in Lissabon. Wir liefen auf und ab, um uns warm zu halten, bis der Flugkapitän schließlich sagte: “Es geht los.” Wir folgten der Besatzung ein Pier entlang und stiegen in ein Motorboot. Schwach konnten wir die Umrisse von zwei großen Flugbooten erkennen, die weiter draußen vor Anker lagen. Als unser Boot vor einem davon Halt machte, sprangen wir durch die Tür.
Das Flugzeug hatte vier Motoren und war größer als die “Baby Clipper” der Pan American Airways. Dennoch war es nicht so groß wie die regulären Flugzeuge dieses Typs. Man hatte es sorgfältig getarnt.
Die Fahrgastkabine war in drei Abteile unterteilt. Im hintersten war Rauchen erlaubt. Ich hatte angenommen, dass diese Flugzeuge jeglichen Reisekomforts aus Friedenszeiten beraubt worden waren, um Gewicht zu sparen, aber dem war nicht so. Die Sitze waren gepolstert und bequem, der Boden mit Teppich ausgelegt.
Der Steward reichte uns Decken. Dann wurden die Motoren angelassen, die Tür geschlossen, und wir fuhren weit hinaus auf den Fluss. Die Lichter der Stadt waren an beiden Ufern klar erkennbar. Plötzlich heulten die Motoren auf, und die Gischt vernebelte die Fenster. Wir fuhren eine gefühlte Ewigkeit auf dem Wasser dahin, bis wir schließlich spürten, wie das Flugboot abhob. Die Sicht durch die Fenster wurde klarer, die Lichter des Ufers verschwanden immer mehr in der Tiefe und die heißen Abgase der Motoren leuchteten dramatisch rot in der Dunkelheit. Wir waren auf dem Weg nach England.
Es hätte ein Flug in Friedenszeiten sein können. Jeder Passagier legte sich sofort schlafen. Ich selbst döste eine Weile, aber da die Neugierde mich nicht wirklich losließ, blieb ich ab Tagesanbruch wach.
Als es hell wurde, befanden wir uns über dem Meer, ohne dass Land in Sicht gewesen wäre. Man hatte mir gesagt, dass der Flug zehn Stunden dauern würde, aber wir hatten jede Menge Rückenwind und schafften die Strecke in weniger als sieben Stunden. Die Zeit zog sich überhaupt nicht. Als ich fünf Stunden nach Abflug durch das Flugzeug ging, schliefen alle Passagiere. Soweit ich beobachten konnte, sprach während der gesamten Reise kein einziger Fluggast mit einem anderen. Es waren sieben Amerikaner an Bord, ein Schweizer und drei Engländer.
Der Steward servierte Kaffee und Sandwiches, später auch Obst. Dann ging er durch die Kabine und verdunkelte die Fenster, damit die Passagiere nicht hinaussehen konnten. Zu diesem Zweck befestigte er Stücke aus Milchglas mit Gummisaugnäpfen über den normalen Fenstern. Das lässt zwar Licht herein, verhindert aber, dass man selbst etwas erkennen kann. Ich vermute, dass die Passagiere so nicht die Konvois im Wasser unter ihnen sehen können. Witzig war aber, dass der Steward alle Fenster außer meinem verdunkelte. Entweder gingen ihm die Milchglasscheiben aus, oder er dachte, ich sei blind. Auf jeden Fall starrte ich den ganzen Flug über aus dem Bullauge.
Auf der linken Seite kam schließlich Land in Sicht. Es war dunkelbraun und kahl, eine hohe, zerklüftete Küste. Ich dachte, es sei Irland. Eine Stunde flogen wir an dieser Küste entlang. Die Luft wurde turbulent und als Folge davon fünf Passagieren ziemlich übel. Irgendwie bin ich davon verschont geblieben. Wir überflogen nur zwei Schiffe, beide offensichtlich ziemlich klein. Eines begrüßte uns mit einem Blinkfeuer. Während des ganzen Fluges sahen wir keine einzige andere Maschine.
Plötzlich drosselte der Pilot seine Motoren und wir verloren an Höhe. Da wurde mir klar, dass wir nicht an Irland entlang geflogen waren, sondern an der Küste Englands. Wir landeten weit draußen vor der Küste inmitten vieler ankernden Boote und getarnten Flugzeugen, die dort vor sich hindümpelten. Als wir auf der Wasseroberfläche aufsetzten, hörte ich dieses vertraute, lang gezogene, knirschende Geräusch.
Ich fühlte mich wie in einem Traum. Die Reise von Amerika war zu Ende –– wir waren angekommen. Aber es schien nicht wirklich real zu sein. Jeden Moment erwartete ich, aufzuwachen und mich immer noch zwischen den Mauern des “Hotels Europa” in Lissabon wiederzufinden.
Ein paar britische Beamte in Regenmänteln und Stiefeln kamen mit einem Motorboot heraus und nahmen alles in Augenschein, während ein Arzt die von uns ausgefüllten Formulare an sich nahm. Dann stiegen wir alle in das Boot. Die Männer unterhielten sich mit uns auf dem Weg zum Ufer. Sie sagten, sie würden versuchen, uns so rechtzeitig durch die Formalitäten zu bringen, dass wir den Nachmittagszug nach London noch erwischten. Versprechen konnten sie es leider nicht.
Es regnete. Wir liefen hundert Meter an den Docks entlang und bogen dann in die Hauptstraße der kleinen Stadt ab. Dort standen Soldaten, an deren Koppeln Helme und Gasmasken baumelten. Ich sah Frauen in khakifarbenen Uniformen und viele Menschen, die auf Fahrrädern unterwegs waren. Alle Schaufenster waren mit Papierstreifen überklebt worden. Das sollte verhindern, dass sie durch die Erschütterung zerspringen, wenn Bomben ganz in der Nähe explodierten. Die vielfarbigen, gemusterten Streifen ließen die Stadt aussehen, als sei sie weihnachtlich geschmückt und nicht für den Krieg hergerichtet worden.
Ich wünschte, Sie könnten diese Dorfstraße sehen. Sie wirkte wie ein Bild aus einem Dickens-Roman. Die gegiebelten Häuser, die Wörter auf den Schildern, die vielen rauchenden Schornsteine, all das war das England der Klassiker der Weltliteratur, so friedlich, ordentlich und sicher. Ich war noch keine drei Minuten unterwegs, als ich mich bereits in das Land verliebt hatte.
Man begleitete uns in einen großen Raum im Erdgeschoss, wo sich das improvisierte Büro der “British Overseas Airways” befand. Dort standen Sessel und Sofas, im Kamin prasselte ein Kohlenfeuer und ein Bediensteter servierte heißen Tee. Es dauerte zwei Stunden, bis wir alle Formalitäten hinter uns gebracht hatten. Wir wurden einzeln in einen Raum geführt, wo wir jeweils von zwei Männern befragt wurden. Sie erkundigten sich nach dem Grund unseres Kommens, nach dem mitgeführten Geldbetrag, danach, wen wir kannten, und so weiter. Es war keineswegs ein Verhör. Sie taten dies auf eine Art und Weise, die einem das Gefühl vermittelte, man säße einfach nur da und plauderte. Die Prozedur war mehr als höflich, sie wirkte sogar äußerst freundlich.
Danach wurde unser Gepäck genauestens untersucht. Sogar unsere Briefe wurden gelesen. Aber die sprichwörtliche englische Höflichkeit ist so groß, dass der Zollbeamte mich sogar bat, jeden Brief für ihn aus dem Umschlag zu nehmen. Offensichtlich dachte er, es würde zu neugierig wirken, dies selbst zu tun! Kurz vor der Abfahrtszeit unseres Zuges sagte er, wir müssten uns beeilen, um diesen noch zu erwischen; also schloss er die Taschen, ohne die Untersuchung zu beenden, gab uns Ratschläge über Züge und die Verdunkelung in London und drängte uns förmlich in ein wartendes Fahrzeug, das von der Fluggesellschaft bereitgestellt worden war.
Wir fuhren eine Viertelstunde lang durch einen dicht besiedelten Vorort. Man erzählte uns, dass dort erst vor einigen Nachmittagen Bomben gefallen seien, aber wir sahen keine Anzeichen dafür. Der gesamte Vorort wirkte wie eine Fortsetzung der Hauptstraße unseres Ankunftsortes –– blitzsauber, urgemütlich, wohnlich und schön.
…