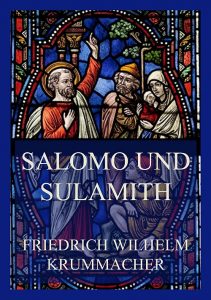Salomo und Sulamith – Friedrich Wilhelm Krummacher
Friedrich Wilhelm Krummacher war ein 1868 in Potsdam verstorbener Geistlicher. Sein Vater, Friedrich Adolph Krummacher, war ein bedeutender deutscher Theologe und Schriftsteller. Friedrich Wilhelm war, obwohl Pfarrer der reformierten Kirche , ein eifriger Verfechter des älteren Luthertums und erregte durch seine Verurteilung der Rationalisten großes Aufsehen. Er kam 1843 nach New York, lehnte eine theologische Professur in Mercersburg, Pennsylvania, ab, kehrte dann nach Deutschland zurück und ließ sich 1847 in Berlin nieder. Um Krummacher’s Kanzel sammelte sich bald eine überaus große Gemeinde. Selbst zu den Wochengottesdiensten strömten die Leute zusammen. Dem dringenden Wunsch der Zuhörer nachgebend, veröffentlichte er eine Reihe von Predigtsammlungen, darunter auch “Salomo und Sulamith.”
Salomo und Sulamith.
Format: Paperback/eBook.
ISBN: 9783849664411 (Paperback)
ISBN: 9783849663551 (eBook)
Auszug aus dem Text:
Erste Predigt – Die Suchende
Hohelied Salomons 3, 1-4.
Ich suchte des Nachts auf meinem Lager, den meine Seele liebt; ich suchte, aber ich fand ihn nicht.
Ich will aufstehen, und in der Stadt umgehen, auf den Gassen und Straßen, und suchen, den meine Seele liebet. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umgehen: Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebet? Da ich ein wenig vor ihnen überkam, da fand ich, den meine Seele liebet. -Ich halte ihn und will ihn nicht lassen, bis ich ihn bringe in meiner Mutter Haus, in meiner Mutter Kammer.
Die Braut, die Gemeinde des Herrn, oder die einzelne gläubige Seele, öffnet uns in der verlesenen Stelle die Schatzkammer ihrer geistlichen Erfahrungen, und erzählt uns etwas aus ihrer Führung und innern Lebensgeschichte, wozu gewiß mancher unter uns in dem, was er selber auf dem Wege des Heils schon erlebt, den Schlüssel finden wird. O! eine feine, tiefe und große Wahrheit, welche in der Erzählung der Braut uns vor die Augen tritt. Was uns an Christum bindet, das muß nicht sowohl der süße Geschmack seiner Güte, als vielmehr das schmerzliche Gefühl unserer Armuth und unseres Elendes sein. Das ist die Wahrheit, in deren große Bedeutung unsere heutige Betrachtung uns tiefere Blicke eröffnen möge.
Nach Anleitung ihrer eigenen Aeußerungen, beobachten wir die Braut mit stetem Blick auf uns, in einer vierfachen Lage:
1. Zuerst wie sie schwelgt in geistlichem Reichthum.
2. Wie sie verliert, was sie hat, und in der Verbannung schmachtet.
3. Wie sie im Wiedersuchen begriffen ist und nicht findet.
4. Wie sie findet um nicht mehr zu verlieren.
I
Ich suchte des Nachts auf meinem Lager. Wen denn? – Den meine Seele liebt. Christum, den Schönsten der Menschenkinder. Christum, den himmlischen Bräutigam. Den hatte die klagende Seele gehabt auf ihrem Lager. Liebliches Bild, mit welchem die ganze Seligkeit des Zustandes angedeutet wird, in dem sie sich zuvor befunden hatte! Sie hatte den Herrn auf ihrem Lager. Den Herrn auf seinem Lager haben, was kann das anders heißen, als bei ihm und in ihm ruhen, seiner beseligenden Nähe auf das Allerlebhafteste und Empfindlichste inne werden, seine Freundlichkeit schmecken, voll sein von warmem, innigem Gefühl der Liebe und Zärtlichkeit gegen ihn, und lauter Lust und Freude empfinden bei der Betrachtung seiner Person, seiner Thaten, seines Wortes. Den Herrn auf seinem Lager haben, was heißt das anders, als seiner Zuneigung und Liebe sich versichert fühlen, seiner Verheißungen und Zusagen im Herzen froh und gewiß sein, erfüllt sein mit andächtigen Rührungen und Bewegungen des Gemüthes, und mit lebendigem innern Drang und Trieb, ihn zu loben und zu preisen, über ihn zu jubeln und zu frohlocken.
Blicket zurück auf die Aeußerungen unserer Braut in den vorhergehenden Versen ihres Liedes. Da sie jubelte: „Der Geruch deiner Salben ist lieblich; dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe.“ Da sie ausrief: „Mein Freund ist mir eine Cophertraube in den Weingärten Engedi. Siehe, mein Freund, du bist schön und lieblich. Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter den Söhnen. Ich sitze unter seinem Schatten, deß ich begehre, und seine Frucht ist meinem Gaumen süße. Er führet mich in den Weinkeller, und die Liebe ist sein Panier über mir. Er erquicket mich mit Blumen, und labet mich mit Aepfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Mein Freund ist mein, und ich bin sein, der unter den Rosen weidet.“ – Da sie also sang und jauchzte, da also das Saitenspiel ihres Herzens klang und tönte, da hatte sie, den ihre Seele liebt, auf ihrem Lager. –
Dieser süße und liebliche Zustand, da man den Herrn auf seinem Lager hat, tritt gewöhnlich in der ersten Zeit der Bekehrung ein. Der Pfingsthauch, der Wind vom Himmel, blaset daher, und unter seinem allmächtigen Wehen schmelzen allmählig, wie Schneedecken, die Hüllen hinweg von der Wüste unseres Herzens und Lebens. – Es zerreißen die Schleier der Selbstverblendung, und ehe wir’s uns versehen, kommt uns, die wir bisher so satt waren und nichts begehrten, unsere große Friedens- und Freuden-Armuth vor die Augen. – Wir fühlen Lücken, die verzäunt, und geistliche Bedürfnisse, die gestillt sein wollen. – Wir finden, daß es mit uns nicht stehe, wie es stehen sollte – und es sagt uns ein lebendiges Gefühl, daß es anders mit uns werden müsse. – Worte und Werke, Gesinnungen und Bestrebungen, die uns bis dahin gut und recht gedünkt, fangen an uns zu beunruhigen, und wir fühlen ein innerliches Nagen, wie eines Wurmes, der nicht sterben, wie eines verborgenen Feuers, das nicht verlöschen will. – Da laufen wir denn um, zu suchen, was uns heilen, und was den wunderbaren Durst der Seele stillen mögte. Aber diese Welt ist nicht Gilead, und ihre Hülfen, Rathschläge und Linderungsmittel sind eitel ausgehauene, löcherichte Brunnen, die kein Wasser geben. – Je mehr wir das erfahren, je mehr wächst unser Hunger und Kummer, daß es endlich gar aus ist mit aller Freude – und alle Thränenquellen sich erschließen, und das Lachen in bitterliches Weinen sich verkehret. – Das ist der Thaumond – da unter dem Brausen des Pfingstwindes die starren Eisesbanden des natürlichen Stolzes und der Unbußfertigkeit zu brechen beginnen, und der Mensch die verdeckenden Hüllen von seinem Jammer schwinden stehet. – Wohin nun? Nun, es ist ein Zug der Gnade da – eine Hand in der Wolke, die leitet sicher, und irret Niemand. – Man kommt zu Jesu, – man schreiet, man seufzt um Gnade, man bekommt Antwort in seine Seele, und nun nimmt der Mai seinen Anfang, nun bricht die Zeit herein, da man, wie die Braut, den Herrn aus seinem Lager hat. Ach Gott, wie einem nun so wohl ist! – Welch ein Leben, gegen das arme, kümmerliche Leben in der Welt gehalten! – Wißt ihr noch, wie es uns war in jener Zeit? Wie da Alles in der Blüthe stand auf unseres Herzens Acker? Wie wir da weinen konnten, wie die Kinder vor Rührung und Freude weinen, so oft wir uns ergötzten im Garten der Schrift, so oft wir gedachten des Herrn, wie er so treu gewesen, und sein Wort und seine Geschichte lasen? – Wie uns das Herz hüpfte und bebte vor Entzücken, wenn wir von ihm zeugen und predigen hörten, wie wir voll Inbrunst waren, wenn sein Lob gesungen wurde und wie wir beten konnten, mit welcher Inbrunst, mit welchem Drang und Trieb, mit welcher Lust und Liebe. – Wie wir nun angethan waren und gerüstet, von ihm zu reden, wie wir nun in einem Nu die Welt bekehren, und von den Dächern und auf den Gassen seinen Namen verkündigen wollten. – Wie wir Mauern suchten. um mit unserm Gott darüber zu springen, und lebendige Steine um ihm schnell einen Tempel zu bauen, – und wir gar nicht begreifen konnten, daß andere Christen so still waren, so ruhig und gehalten, und nicht die Fülle unserer Empfindungen teilten und nicht in unsern Jubel einstimmten, ja wohl gar im Stande waren, zu klagen und zu seufzen, da wir für immer ausgeklagt und ausgeseufzt zu haben meinten. – Gedenkt ihr noch an diese Zeit? – Da hatten wir in dem Sinne. in welchem die Braut es meint in unserm Texte, den Herrn auf unserm Lager. Dieser Stand war süß und selig, aber es durfte dann für unsere Seele kein Bleibens sein. Der Herr mußte uns zu seiner Zeit aus diesem Lande Gosen geistlicher Vergnügungen, von dieser fetten Weide der Empfindungen, wieder ausführen. – Denn hüben wir nicht schon heimlich an, in dieser Lage übermüthig zu werden und um der seligen Aufgeregtheit unseres Gemüthes wollen, uns für große Heilige zu halten, für Sonderlinge vor Andern? Begannen Wir nicht schon in der Freude über unsern Reichtum des Bettelstabes uns zu schämen, und ließ der Drang und das Bedürfnis nicht schon nach, anzuklopfen an die Gnadenpforte, und mit den Armen und Elenden an der Thüre des reichen Herrn uns zu lagern? – War es nicht schon im Grunde weit mehr unser eigenes Frommsein und unsere Empfindungsfülle. worauf wir bauten und fußten, und um weßwillen wir dem Gericht zu entrinnen hofften – als Christus und sein Verdienst? – Fingen wir nicht schon an. den Grund unserer künftigen Seligkeit in uns zu suchen, anstatt allein außer uns in dem Gekreuzigten? – Und was wir liebten, war es nicht weit mehr das Brod womit uns Christus speisete, der Wein, damit er uns tränkte, als Er selbst? – Wir liebten ihn, ja. wir hingen ihm an. allerdings. Was war es aber für eine Liebe? – War es jene ernste, heilige, feste Liebe. die da ihren Grund hat im Bewußtsein: Christus ist mein Blutbürge. der mein Leben aus der Hölle gerissen hat. und dem ich’s danke daß das Feuer des Gerichts mich nicht verzehret? – War es jene Liebe, die da geankert ist in dem beugenden Gefühl: ich bin nicht werth, daß die Sonne mich bescheinet, und Christus hat die Himmel verlassen, um meinetwillen, – um meine, den Teufeln verfallene Seele zu retten und mit seinem Leben zu erkaufen? – War es jenes Anhangen an ihn und jenes Festklammern, das seinen Grund hat in der lebendigsten Anerkennung unserer gänzlichen Ohnmacht, Nichtigkeit und Untüchtigkeit, und in der Ueberzeugung, daß man jeden Augenblick von Christi Gnade leben müsse? – O nein, so weit reichte unser Blick noch nicht, weder in uns selbst und die Tiefe unseres Verderbens, noch in den Abgrund der Verdienste Christi. Wir hatten nur erst oben abgeschöpft, sowohl vom Pfuhle unserer Verwüstung, als von dem grundlosen Meere der Liebe und Barmherzigkeit des Mittlers. Nur oberflächlich konnte darum auch unsere Liebe zu ihm sein. – Einzelne Sünden waren uns wohl schon vor die Augen gekommen, aber unsere Sündigkeit noch nicht; diese, jene Uebertretung, aber noch nicht die ganze wüste und zerrüttete Grund unseres Herzens; – ein und der andere Auswuchs, aber noch nicht der böse Saft, der uns durchströmt, noch nicht das ganze Bild Belials, das wir in uns tragen. Mit einem Wort: wir waren für Christum noch mehr eingenommen, des süßen Geschmacks seiner Gaben wegen, als daß wir durch das Gefühl unseres Elendes und seiner Unentbehrlichkeit zu unserem Heil an ihn gebunden gewesen wären. – Und das ist ein laxes und loses Band, das eine Liebe, die jeder Wind der Anfechtung auslöschen kann, – nicht aber eine feurige Gluth, die stark ist wie der Tod, fest wie die Hölle, – und die auch viele Ströme nicht ersäufen können. –
…