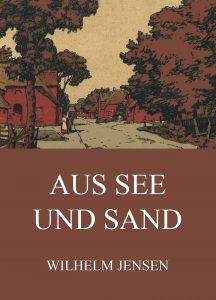Aus See uns Sand – Wilhelm Jensen
Ein Entwicklungsroman aus Jensens Heimat zwischen Nord- und Ostsee. Der in Heiligenhafen (Holstein) geborene Schriftsteller gehört mit über 150 Werken, oft mit historischem Hintergrund, zu den produktivsten Autoren seiner Zeit.
Format: eBook
Aus See uns Sand.
ISBN eBook: 9783849656010.
Auszug aus dem Text:
Der junge Dorflehrer in Loagger, Tilmar Hellbeck, kam von einem Nachmittagsausgang ins Schulhaus zurück. Ein Gebäude war’s, in seiner Bauart den anderen Häusern des Strandkirchdorfes gleich, einstöckig, von weit niederhängendem, dunkelbemoostem Strohdach bedeckt; nur wenig Fenster sahen darunter hervor, wie Augen unter übernickendem Haar, doch jedes aus vielen winzigen Scheiben zusammengesetzt. Nach Westen auf die Nordsee blickte keines aus, hier wie überall; von dort kam fast beständig durch das ganze Jahr der Wind, oft als Sturm, Seewasser oder Sand durch die feinsten Ritzen peitschend, und alle Dorfhäuser kehrten ihm feste Mauern zu, meistens die Rückwand der mit dem Wohnhaus zu einem verbundenen Scheune. Die fehlte jedoch dem Schulgebäude, zu dem kein Acker- oder Weideland gehörte. Nur für die winterliche Unterbringung eines halben Dutzend von Schafen befand sich ein kleiner Stallanbau an der Westseite.
Tilmar Hellbeck war von schmächtiger Gestalt und schmalem, blaßfarbigem Gesicht; seine Augen boten die Ähnlichkeit mit den Fenstern des Schulhauses, daß sein Haar Neigung trug, vom Stirnrand auf sie herunterzufallen und ihn veranlaßte, es gewohnheitsmäßig, manchmal mit einem leichten Aufruck, wieder emporzuwerfen. Das Haar gehörte der blonden Art an, doch machte es trotzdem einen dunklen Eindruck; aus der Entfernung erschien es wie vorzeitig ergraut, mußte indes täuschen, denn er stand erst in der Mitte der zwanziger Jahre, und beim Näherkommen zeigte es sich von einer mattem Stahl ähnelnden Färbung. Seine Kleidung war nicht bäuerisch, sondern städtisch, erkennbar mit einer gewissen Sorglichkeit gehalten, doch abgetragen, an Stellen beinahe fadenscheinig. Sie sprach von ärmlichen Verhältnissen, wie deutlicher noch die Magerkeit der Züge von karger Ernährung. Den Umständen gemäß war das Lehrergehalt in Loagger ein recht klägliches.
Trotzdem hatte er sich vor drei Jahren glücklich geschätzt, die Stellung zu bekommen. Durch mühevolle Arbeit und Entbehrung seiner Mutter war’s ihm, der seinen Vater kaum mehr gekannt, ermöglicht worden, sich zum Volksschullehrer auszubilden. Jahrzehnte schweren Lebenskampfes waren es für jene gewesen, da sie, nach der landläufigen Benennung von »besserer« Abkunft, nicht in der Voraussicht aufgewachsen, sich und ihrem Kinde einmal mit ihren Händen den Unterhalt verdienen zu müssen. Doch Mutterliebe hatte sie ausdauernd zur Erreichung des Zieles gemacht, das sie sich für ihren Knaben vorgesteckt, ihn vor der Nötigung zu einem Handwerk zu bewahren. Wenn es ihr auch nicht möglich geworden, ihn der Überlieferung ihrer Familie gemäß auf eine gelehrte Laufbahn zu bringen, machte der Lehrerberuf ihn doch einem Bildungsstande zugehörig. Rastlos, mit eisernem Fleiß hatte er selbst gearbeitet, die Hoffnung seiner Mutter zu erfüllen, ihre Mühen und Sorgen vergelten zu können, denn sein Herz hing an nichts auf der Welt, als an ihr, wie das ihrige an ihm. Und so war’s geschehen, im letzten Augenblick höchster Bedrängnis; als ihre Kräfte erschöpft zusammengebrochen, sie nicht mehr weiter gekonnt, der Hungertod ihnen ins Gesicht gestarrt, hatte die Schulbehörde ihm die durch Todesfall erledigte Lehrerstelle in Loagger übertragen. Kümmerlich war sie, aber ließ nicht verhungern, gewährte ihm das Höchste, jetzt seine Mutter, die früh Gealterte, erhalten zu können. Wie ein vom Himmel herabgefallenes Glück hatte er das Amt in dem einsamen, weltentlegenen Stranddorf übernommen; eine erste Stufe wenigstens, auf der er Fuß gefaßt, sich von ihr höher und freier weiter zu heben.
Spätnachmittag im Aprilanfang war’s, und eine weiche Luft kündigte Herannahen des Frühlings. Wie der junge Lehrer, eine alte blecherne Botanisierbüchse am Band über der Schulter tragend, von seinem Ausgang zum Schulhaus zurückkam, saß Frau Margret Hellbeck, mehr weiß- als grauhaarig, auf einer Bank vor der Tür, nach Bauernfrauenbrauch altmütterlich mit den mageren Fingern an einem Spinnrocken tätig. Halb überrascht begrüßte sie den Herantretenden: »Kommst du schon wieder, Til? Ich dachte, bei dem schönen Wetter bliebest du länger aus. Der Winter war lang, da tut’s wohl im Freien.«
Er antwortete: »Aber macht auch müde, man muß sich erst wieder gewöhnen. Ja, liebe Mutter, dir tut’s gut hier draußen, das macht mich froh; du siehst prächtig aus.«
Das Aussehen der alten Frau war in der Tat ein gesundes, weit besseres, als es bei ihrer Hierherkunft vor drei Jahren gewesen. Sie hob den Kopf auf, doch schüttelte sie ihn zugleich und erwiderte:
»Von dir kann ich’s nicht sagen, du bist blaß, und in deinen Augen sieht man nicht, daß du froh bist. Schon länger sah ich’s und kann’s mir wohl denken; dein junges Leben paßt nicht hierher, hat zu wenig, du hast gedacht, daß du schneller vorwärts kämst. Hättest du nicht um meinetwillen die Stelle hier angenommen, wärst du wohl auch schon weiter, aber ich bin dir ein rechter Klotz am Bein.«
Auch er machte jetzt rasch eine verneinende Kopfbewegung. »Du weißt, liebe Mutter, ich bin gern hier – um deinetwillen.« Das letzte schien er etwas unbedacht beigefügt zu haben, trachtete danach, es anders auszulegen: »Ich meine, mir kann’s nur wohlgehen, wenn du gesund und rüstig bist, und dir bekommt die Luft hier besser, als in einer Stadt. Mir fällt es heute besonders auf, wie hell du aus den Augen siehst.«
Margret Hellbecks Mund hatte sich lange Jahre des Lachens entwöhnt gehabt, doch die erdrückende Bürde jener Zeit war von ihr abgefallen, und das Leben lag noch einmal vor ihr wie zu einem fröhlichen Aufstieg. Die Naturanlage ihres Gemüts mochte eine heitere gewesen sein, um die alten Lippen spielte ihr gegenwärtig ein beinahe schelmischer Ausdruck, so gab sie Antwort:
»Mir hat das linke Ohr gejuckt, und vorhin flog eine Möwe übers Dach, die rief etwas. Verstehen konnt ich’s nicht, aber ich glaube, Til, es muß heute etwas Gutes für uns geben; deshalb halte ich die Augen recht auf, damit es nicht an ihnen vorbeikommen kann, ohne daß ich’s sehe. Alte Weiber sind einmal abergläubisch, und ich will’s doch versuchen, ob ich’s nicht auch noch lernen kann, Karten zu legen und aus dem Kaffeesatz zu prophezeien.«
Nun lachte sie wirklich, ein liebes, altes Gesicht war’s. Der Sohn nickte freundlich: »Das würdest du gewiß und eine weltberühmte Wahrsagerin werden, von der Kaiser und Könige sich weissagen ließen. Nur müßten wir uns erst Kaffee zum Trinken anschaffen; schade, daß er so teuer ist und aus unserer großen Zukunft deshalb nichts wird. Doch auch zum Trinken wäre er für eine frühaufstehende Frau – für ein altes Weib – besser als Milchsuppe; mir wär’s ein Glück, wenn unsere Einnahme dazu ausreichte, Kaffee für dich ins Haus zu bringen, liebe Mutter.«
Das letzte klang vom Herzen her, ein zum erstenmal über die Lippen gebrachter Wunsch, dessen Erfüllung die Umstände versagten. Nun trat Tilmar auf den gestampften Lehmboden des Hausflurs; zur Linken führte eine niedrige Tür in den Wohnraum der beiden, gegenüber nach rechts lag die Schulstube von wenig Umfang. Drei kurze Bank- und Tischreihen hintereinander wiesen auf nur geringe Besucherzahl hin, dem kleinen Schulsprengel gehörten außer Loagger bloß noch zwei landein belegene Heidedörfer an. Die blankgeputzte Holzdiele legte Zeugnis von der Arbeitsamkeit und Sauberkeit Frau Margrets ab, sie hielt alles im Hause selbst imstand, wie sie auch die Wirtschaft ohne eine Beihilfe besorgte; dazu hätten die Einkünfte gleichfalls nicht ausgereicht. Auf den Schultischen lagen da und dort einige abgerissene Katechismen, Gesangbücher und zersplissene Schiefertafeln, von den am Vormittag stattfindenden Lehrstunden redend. Offenbar füllte sie nur der niedrigste Elementarunterricht aus; die Vorstellung, daß Tilmar Hellbeck, ihn erteilend, täglich lange Stunden vor barfüßigen Dorfkindern auf dem alten wackelnden Pult zubringe, einem Lebensberuf damit Genüge leiste, stimmte nicht recht mit dem Ausdruck seiner Züge und seinem Wesen überein. Unverkennbar trug er mehr in sich von natürlicher Begabungsmitgift wie durch erworbene Kenntnisse Anwartschaft auf eine höhere Tätigkeit. Wohl fehlte ihm klassische Bildung, da er kein Gymnasium zu besuchen vermocht, nur für Aufnahme in einem Lehrerseminar befähigt gewesen. Doch über die Obliegenheiten seiner hiesigen Stelle ragte er entschieden weit hinaus, hätte eher angemessene Aufgabe an einer Bürgerschule gefunden. Seine Mutter hatte recht, er mußte sich unbefriedigt fühlen und von hier fortsehnen. Aber aus Liebe zu ihr verneinte er diesen natürlichen Drang, stellte sich vollzufrieden mit seinem Aufenthalt in Loagger, um zu verhüten, daß sich in ihr ernstlich das Gefühl festsetze, ihm für sein Weiterkommen hinderlich zu sein. Das wußte sie auch, denn er war der beste, opferwilligste Sohn. Indes aus seiner Gesichtsfarbe, seinen Augen und einer Veränderung seines Wesens sprach ihr schon seit längerem, was sein Mund verschwieg.
An die Schulstube stieß ein kleines Gelaß, das er sich als Arbeitskammer eingerichtet hatte. Auf Wandgestellen, von ihm selbst aus Bretterabfällen gezimmert, standen seine Bücher, zum Teil für seine Lehrerausbildung und seinen Beruf notwendig gewesene. Doch machten sie nur die Minderzahl aus, ungefähr ein Viertel; der übrigen hätte er als Dorflehrer nicht bedurft. Allen sah man an, daß sie bei Büchertrödlern, wahrscheinlich auf Jahrmärkten umziehenden, als wertlose, von niemand mehr begehrte Ware um Groschenpreise billigst zusammengekauft seien; eine kleine Ansammlung von alten, schlechtgedruckten geographischen, historischen, naturgeschichtlichen Leitfäden und Lehrbüchern war’s, fast alle aus dem vorigen Jahrhundert stammend. Ebenso ein Dutzend Bändchen mit schönwissenschaftlichem und poetischem Inhalt, herausgerissene Hefte aus den Schriften Herders, defekte früheste Ausgaben Schillerscher und Goethescher Gedichte, ein anfang- und schlußloses Stück von Wielands Oberon. Für alles miteinander hätte ein Antiquar schwerlich einen Taler zum Ankauf aufgewendet.
Auch die nicht von den Büchern eingenommenen Gestellbretter waren, wenngleich andersartig, doch ebenso dicht besetzt oder richtiger belegt. Verschiedenartige Steine vom Strand, Muscheln, getrocknete Seesterne lagen darauf; zwei kleine besondere Abteilungen enthielten vom Wasser ausgeworfene Petrefakten und ein paar aus Kieseln zurechtgefertigte Messer und Pfeilspitzen der Steinzeit. Sämtliche Gegenstände befanden sich geordnet, mit Blättchen versehen, die zum Teil eine Aufschrift zeigten, zum Teil leer waren. Einen Bord füllten mehrere Stöße zwischen grauem Papier gepreßter Pflanzen, unter denen gleichfalls zumeist Namen geschrieben standen, deutsche, doch auch manche lateinische, die letzteren überall in sorgsam hergestellter Schönschrift. Keine Sammlungen wissenschaftlicher Bildung waren es, sondern die eines Ungelehrten: aber man sah ihnen Eifer an, heißes Bemühen, in ihre Gebiete einzudringen, die Gegenstände mit Namen zu bestimmen, nach ihrer Zusammengehörigkeit zu ordnen, Kenntnisse zu erwerben und zu erweitern. Nebenan stand Tilmar Hellbeck als Lehrer vor dem Pult, hier dagegen saß er als Lehrling, nur auf sich selbst und seine alten, ihm vom Zufall in die Hände getragenen Bücher angewiesen. Aus ihnen suchte er einen Wissensdurst seines Innern zu stillen, doch einem Schöpfen karger Tropfen in hohler Hand glich’s. Seine kleinen dilettantischen Sammlungen boten ein ziemlich treues Abbild dessen, was er sich autodidaktisch im Kopf angesammelt hatte. Überall gebrach’s ihm an Wissen und an den einschlägigen Hilfsmitteln, hauptsächlich vielleicht an richtiger, im Knabenalter nicht erworbener Schulung des Geistes. Aber heftiger Drang nach höherer Ausbildung desselben lebte in ihm, und in seinen Augen stand zu lesen, hinter der schmächtigen Stirn arbeite eine Phantasiemitgift, die ihm oft mangelnde Kenntnisse ersetzte, eine lebendige Anschauung vor den Blick bringe, wo seine Kunde nicht ausreiche.
Nun setzte er sich vor den Tisch der engen Kammer und leerte den mitgebrachten Inhalt seiner Blechbüchse auf ihn aus, einige Pflanzen mit hartem, salzdurchtränktem Blattwerk, stahlfarbig sich als überwintert offenbarend. Nur ein Kraut zeigte, eben vom Frühling aufgetrieben, schmale, hellgrüne Blättchen, doch noch ohne Andeutung eines Blütenstiels; April war’s erst und unter dem nordischen Breitengrad die Knospenzeit noch nicht gekommen. Der junge Selbstlehrer nahm einen vergriffenen Band vom Gestell herunter, ein altes botanisches Handbuch ohne Titelblatt, abbildungslos, dürr-systematisch. Nach dem bemühte er sich, freilich nicht selten vergebens, seine Funde zu bestimmen, und suchte dies auch jetzt zu tun. Die kleine blütenlose Pflanze bot wenig Aussicht auf Erfolg, aber Glück kam ihm heut entgegen, so daß er nach einer Weile des Untersuchens und Prüfens zur Kielfeder griff und auf ein Blatt schrieb: »Strandnelke, Armeria maritima.« Er sprach es laut vor sich hin, doch bei dem letzten Wort den Akzent falsch auf die vorletzte Silbe legend; es ließ hören, daß er kein Latein gelernt habe, so betone, wie der Klang ihm am besten gefalle. Auf die halmartigen Blättchen schauend, sagte er nochmals laut: »Wie mag sie blühen? Ich kann mich nicht erinnern, sie gesehen zu haben.« Seine deutsche Ausdrucksweise war die eines Vollgebildeten, und die Stimme besaß einen schönen, eigenartigen Ton. Er neigte dazu, mit sich selbst zu sprechen, die Einsamkeit seiner Lebensführung hatte ihn daran gewöhnt, wohl im Verein mit der regen Tätigkeit seiner Phantasie, die das Gedachte und Gefundene, gleichsam zur Vergewisserung, gern auch dem Ohr vorhielt.
….