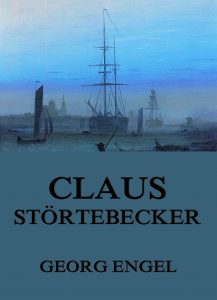Claus Störtebecker – Georg Engel
Claus Störtebecker war ein Seeräuber und neben den berüchtigten Kapitänen Gödeke Michels, Hennig Wichmann, Klaus Scheld und Magister Wigbold einer der Anführer der auch als Likedeeler (Gleichteiler) bezeichneten Vitalienbrüder. Engels wohl bekanntester Roman zeichnet dessen Leben und Abenteuer nach.
Format: eBook/Taschenbuch
Claus Störtebecker.
ISBN eBook: 9783849655143
ISBN Taschenbuch: 9783849669454
Auszug aus dem Text:
Sommerabend. – über die Buchenwipfel droben auf den Dünenhöhen fährt ein Rauschen. In langer Kette wälzt sich das bewegliche Gold der Sonne durch die aufgescheuchten Zweige. Und zwischen den grauen Stämmen steht blaß und aufrecht das Schweigen und starrt mit seinen unbeweglichen Zügen auf die tanzende See.
Das Meer aber spricht. Seine Augen sind bald tiefblau, bald purpurn, und wild blitzen sie, wenn das Element herüberruft zu den Kreidefelsen, die sich dicht unter die Wälder schmiegen wie ein weißes Knie unter ein grünes Gewand.
Was das Meer ruft, das versteht niemand. Denn nur selten horcht ein menschliches Ohr in den Wind, obwohl es manchmal von dort klingt, als donnere von draußen eine Forderung herüber oder ein vergessener Schrei aus fernen Zeiten. Doch zu deuten vermag man die Sprache des Wassers nicht. Und dann liegt der ungeheure Spiegel wieder still. Das Abbild des einzelnen strahlt er niemals wider, so tief man sich auch beugt, aber die Bewegungen des Himmels malt er ab, der goldne und der silberne Wagen rollen über seine Scheibe, die Zeiten huschen über ihn hinweg, und ein Kranz von Völkern faßt ihn ein.
Sommerabend.
Und in der Rüste des Tages, gerade als der purpurne Ball sich im Wasser kühlt, da steigt eine andächtige Stunde herauf. Da stockt der Tanz der Zeiten über dem Meer, der Zug der Völker wallt deutlicher, und die Vergangenheit schickt vom Rande des Horizontes ihr Schattenschiff an die Gestade der Lebendigen.
Ich stehe am Ufer und sehe die Scharen aus dem Fahrzeug an mir vorüberquillen. Sie tragen meine Züge, sie reden meine Sprache, es sind Menschen, die nicht tot sind, denn der Mensch stirbt nicht auf Erden, weil sein Geschick dauert. Unvermutet bin ich selbst in den Segler der Schatten gestiegen, und ich fühle, wie ich zurückgleite in den Nebel der Jahrhunderte. Oder vorwärts?
Von den Küsten der Vergangenheit zu den Gestaden der Gegenwart schwimmt das Schiff unaufhörlich hin und wider. Es trägt, was lebend ist von den Toten, und trägt das Tote fort zu den Gewesenen. Und dann gelangt es an einen Strich, wo man die Stimmen von beiden Küsten unterscheidet, wo sie sich mischen und ergänzen.
Horcht! Laßt uns lauschen!
Dort, wo jetzt Saßnitz seine terrassenförmig ansteigenden weißen Villen über der Ostbucht von Rügen erhebt, da träumte zum Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts tiefe Ruhe in den waldgekrönten Schluchten. Eine Ansiedlung gab es noch nicht, und der Küstenstrich führte nach der Ansicht grüblerischer Zisterziensermönche aus dem nahen Kloster nur deshalb seinen Namen, weil Graf Harro von Cona ein paar seiner “Sassen”, die man auch Leibeigne nennen konnte, dort in eine elende Bretterhütte behaust hatte, damit sie ihm von nun an fleißig den seltenen Seelachs fingen. Einen Lohn erhielten die unfreien Fischer dafür nicht, sie durften sich den Zehnten ihres Fangs behalten, das übrige aber mußten sie mit einem Strandvogt abrechnen, der mit Zahlen und Peitsche wohl umzugehen wußte. Eine besondere Vergünstigung bestand darin, daß es den Sassen vergönnt war, auch am Sonntag zu fischen. Allein die Beute war des Klosters, denn Graf Harro galt als ein frommer Mann und legte Wert darauf, seinen Lachs häufig in Gesellschaft des Abtes zu verspeisen. Wenn dann der geistliche Herr hie und da an den Hof des Herzogs von Wolgast ritt, dann ließ der Gottesmann wohl auch unauffällig etwas von den Wünschen des Conaer Grafen fallen, und so bezahlte sich der Lachs, und die armen Fischer arbeiteten heimlich und ohne daß sie es ahnten, an der Größe ihres Herrn mit. Freilich, sonder Bewußtsein. Denn in der gebrechlichen Hütte lebte man dahin ohne Kenntnis von den Dingen der Welt. Man stand auf, fuhr aufs Meer und warf sich abends auf die Schilfstreu, gleich einem Werkzeug, das nach dem Gebrauch wieder in die Ecke gestellt wird. Das gleichmäßige Schwelgen aber, das sich die Bewohner der Hütte einander vererbten, es schrieb sich dennoch her von einem Ereignis, vor dem die Sassen eben auf Zeiten hinaus verstummt waren. Etwa um 1366 hatte es sich zugetragen.
Der Platz in der Hütte war durch Todesfall wieder einmal erledigt. Da wurde in den Bretterbau ein Sasse gesetzt namens Claus Beckera. Als der Vogt ihn hineinführte, da lachte der gräfliche Beamte und meinte: “Nimm dich in acht, Claus, daß du das Querhölzlein nicht schädigst.” Und diese Warnung galt mit Recht, denn der neue Bewohner mußte sich tief bücken, bevor er die Schwelle überschritt. Zu riesenhaft ragte er an Wuchs und Gliedern, und ein langer fuchsroter Wirrbart hing ihm bis auf den Leib. Wer ihn nicht genauer kannte, der mochte ihn infolge der Haarwildnis für einen gereiften Mann schätzen. Er zählte aber erst fünfundzwanzig Jahre und war ein harmloser, gutmütiger Bursche, kundig des Legens und Knüpfens der Netze, und ein Meister mit der Axt. Bald fing er auch an, allerlei Gerät damit zu schaffen. Er baute einen hölzernen Stall für ein paar Ziegen, er wölbte über dem offenen Ziegelherd einen Rauchfang mit einem Abzug, ja eines Tages begann er sogar die lehmige Erde zu bahnen und legte Dielen. Alles, als wenn er geahnt hätte, was ihm bevorstand. So war der Herbst hereingebrochen. Durch die Wälder der Höhen wogte es, ein Knarren und Ächzen klagte um die Hütte auf ihrem einsamen Hügel, und die Seegräser auf dem gelben Sand pfiffen und schwirrten, als ob die Sichel auf einem Stein geschliffen würde. Unten stürzten die Schäumer schmetternd gegen die gewaltigen Steine, jedoch Claus Beckera merkte nichts von diesem ewigen Streit, denn eine finstere Nacht wölbte sich über der Leere, und er selbst hockte geruhsam in seinem breiten Armstuhl, den er erst vor kurzem aus rohem Eichenholz gezimmert, und beim Schein eines qualmenden Buchenfeuers auf dem Herd rieb er eifrig an einem eisernen Widerhaken, wie er zum Aalstechen benutzt wurde. Sein roter Bart glänzte gleich einer feurigen Welle. Dazu grölte er ein uraltes Schleiferlied:
“Wetze gut.
Dann schnett se gut –
Der Claus, der ist der Sigrun gut.”
Zwar besaß er keinerlei Beziehung zu solch einem Menschenkind, kannte wohl auch kaum die Trägerin eines derartigen Namens, doch der schärfenden Wirkung des Liedes tat dies keinen Abbruch.
Das Buchenfeuer puffte, und der Riese rieb mit seinem Stein immer emsiger über das Eisen, bis blaue Funken unter seinen Händen hervorspritzten.
Da wurde mit klirrender Faust an die Tür geschlagen, zwei-, dreimal, das leichte Holz zitterte, und in der Hütte dröhnte es wider.
“Sachte”, murmelte Claus, der vor Verwunderung aus seiner gebückten Stellung nicht emporfinden konnte. “Wie? Was? Ein Mensch?” Er versuchte sich zu sammeln und schüttelte in dumpfem Erstaunen den gewaltigen Haarbusch; so was stellte sich hier doch nur selten ein.
“Mach auf”, forderte draußen eine rauhe Stimme, und von neuem regte sich ein kurzes Rasseln.
…..