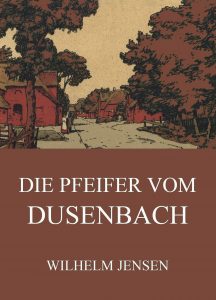Die Pfeifer vom Dusenbach – Wilhelm Jensen
Eine romantische Erzählung aus dem Elsaß. Der in Heiligenhafen (Holstein) geborene Schriftsteller gehört mit über 150 Werken, oft mit historischem Hintergrund, zu den produktivsten Autoren seiner Zeit.
Format: eBook
Die Pfeifer vom Dusenbach.
ISBN eBook: 9783849656041.
Auszug aus dem Text:
Ziemlich in der Mitte zwischen den Städten Kaysersberg und Markirch lag nordwärts von der ersteren das Dorf Altweier. Dreitausend Fuß hoch über dem Rheintal, bildete es die höchstgelegene Ortschaft im Wasgengebirg, mit seinen armseligen Behausungen weithin durch Berggestrüpp, Stein und Haiderücken verstreut, als hätte graue Riesenfaust einmal eine Hand voll Menschendürftigkeit aus den Wolken in die Wildnis hinuntergeworfen. Hier war sie, gleich den Disteln und Ginsterbüschen, seit unbekannter Vorzeit fortgewuchert, mutmaßlich schon von Keltentagen her, denn weder die Deutschen im Elsaß noch die Franken drüben in Lothringen verstanden die Sprache der Bewohner des Dorfes. Ein wortarmer Überrest der ausgestorbenen Urbevölkerung, gurgelte sie in häßlichen Kehltönen, vereinzelt mit völlig entstellten Redeausdrücken der Nachbarländer untermischt, zumeist Tierlauten ähnlicher als menschlicher Zunge. So glichen auch die Bauerngehöfte vielfältig mehr großen Stollen und Felslöchern vom Fuchs und Dachs als Menschenwohnungen, die besten waren roh aus umborkten Waldstämmen gezimmerte Hütten; die Zugänge von ihnen starrten von kotigen Lachen und die rauchschwarzen Wände drinnen von Schmutz. Die Insassen kannten es nicht anders, denn von drunten stieg niemand zu ihnen herauf, und sie selbst kamen kaum einmal im Leben zu einer der Städte im Tal hinunter. Wie die Vorväter seit Jahrhunderten gelebt, führten sie ihr Dasein weiter, hartschwielig an den Fäusten und den nackten Füßen, die nur die Bejahrten und die Weiber mit plumpen Holzschuhen bekleideten. Ohne Kenntnis eines Dinges, das über die Kammwelle ihres Berggürtels hinausreichte, wuchsen die Burschen und Dirnen auf, bis der Trieb der Natur wechselseitiges Begehren in ihnen wachrief. Unterschied von arm und reich setzte dem kein Hindernis entgegen; das Paar, welches unter sich übereingekommen war, ging kurzen Wegs zu der kleinen Kirchenkapelle an einem Schluchtrande des Dorfes und ließ sich vom Pfarrer mit einer von diesem selbst kaum verstandenen lateinischen Formel zu christlicher Ehegemeinschaft zusammensprechen. Nur bei solchen Anlässen unterschied sich der “geistliche Herr” von ihnen durch einen übergeworfenen, verschabten Chorrock, in den anderen Tagesstunden mühte er sich, gleich den Bauern, mit Hacke und Grabscheit um seinen Lebensunterhalt. Er mußte ein Kind aus dem Dorfe sein, sonst hätte die Gemeinde seine Sprache nicht begriffen. Öfter war die Pfarrei jahrelang nicht mit einem solchen zu besetzen und lag, von den Behörden im Elsaß vergessen, völlig verwaist. Dann heirateten die Dorfbewohner ohne geistliche Beihilfe, zeugten Nachkommen, die sich ungetauft in fast nacktem Naturzustand mit den jungen Schweinen, oft kaum von diesen unterscheidbar, in den Wegsümpfen zwischen den Hütten umherwälzten, und ließen sich von dem Strohsack, auf dem sie ihren Atem ausgehaucht, ohne letzte Ölung in den steinigten Boden um die Kirchenmauer hineinscharren. Aber sobald wieder ein Pfarrer droben eintraf, ward jedesmal die fehlende Taufe und der verabsäumte Grabsegensspruch sorglich nachgeholt; nur die Notumstände, nicht heidnischer Sinn oder Mangel an Frömmigkeit, hatten die Gemüter zu ihren eigenmächtigen Lebens- und Sterbenshandlungen veranlaßt. Im Gegenteil, die Vorschriften und Satzungen der Kirche machten fast ihr einziges und unverbrüchliches Gesetz aus; jede feinere Gesittung war ihnen unbekannt, doch anvererbte christliche Gewöhnung trat an die Stelle derselben und ließ die Abwesenheit weltlicher Ordnung und Rechtspflege niemals entbehren. Dennoch lag der Segen des Himmels nicht mit übermäßiger Sichtbarkeit auf der Gemeinde, weder auf der Viehzucht noch auf den Äckern und ihren Bebauern. Wolf, Luchs und Bär brachen oftmals zwischen die weidenden Rinder, Schafe und Ziegen herein und verschleppten ihre Beutestücke in unzugängliches Dickicht der unabsehbaren Wälder; den Anbau von Kornfrucht ließ die Hochlage und magere Beschaffenheit der Erdkrume nur an wenigen geschützteren Stellen und in günstigen Jahren zu, doch auch im besten Sommer vernichtete wilder Wettersturm und Schloßensturz nicht selten plötzlich die mühsam herangereiften Ähren dicht vor der Ernte. Fast am wenigsten indes noch sprach sich eine besondere Fürsorge der Vorsehung in der leiblichen und geistigen Begabung der Dorfbewohner aus. Beinahe ausnahmslos waren diese von untersetzter, unansehnlicher, wenig kraftvoll entwickelter Gestalt, die Mädchen ohne jede Anmut der Jugend, unschön an Wuchs und Zügen und vorzeitig alternd. Sie teilten dies vielleicht mehr oder minder mit der hartarbeitenden Bevölkerung auch anderer weltabgeschiedener Gebirgsgegenden, aber es kam etwas hinzu, das ihnen auf der Stufenleiter des Mißgeschicks der Geburt einen traurigen Vorrang einräumte. Unter dreien dort in die Welt geborenen Kindern gelangte mindestens eines nicht zu einer naturgemäßen Entwicklung seiner körperlichen und seelischen Fähigkeiten, sondern blieb häufig an Leib und Geist unter der Stufe eines aufgeweckteren Tieres zurück. Auf dünnen, haltlos-gebrechlichen Beinen schleppten die Verkrüppelten sich schon als Kinder mit greisenhaften Gesichtszügen, dicken Wulsten am Halse und blöd grinsenden aufgeworfenen Lippen umher. Das borstige Haar sträubte sich am stirnlosen Vorderkopf fast auf die fahlen Brauen herab, unter denen den Begegnenden ein paar scheustiere Augen anglotzten. Bei manchen nahm das Wachstum nach dem ersten Jahrzehnt nicht mehr zu, andere taumelten in Mannesgröße mit unförmlich gedunsenen Körperrumpfen. Die am schlimmsten Verwahrlosten betrieben den Tag hindurch als einzige Beschäftigung, sich unter widrigen Kehltönen um zufällig aufgefundene eßbare Gegenstände zu balgen und diese heißgierig zu verschlingen; nur wenige schritten so weit in der Ausbildung ihres Gehirns vor, daß sie, stumpfsinnig vor den Türen sitzend, hölzerne Löffel und Näpfe auszuhöhlen erlernten oder ihnen bei Aushilfefällen die Hütung des Viehes anvertraut werden konnte. Drunten im Rheintal ward das Dorf deshalb spöttisch als das “Kielkropfnest” bezeichnet, aber kaum jemand hatte es mit Augen gesehen, und die eigenen Bewohner gewahrten, von der Gewohnheit des Anblicks abgestumpft, kaum den halb tierischen Zustand der leiblichen und geistigen Krüppel mehr. Der Himmel über ihnen, der Boden unter ihnen war rauh und hart wie der Notzwang ihrer Lebensfristung. Aber so hatten sie’s von Urvätern als Erbteil übermacht bekommen und so war’s geblieben, und auch der Gang von vier weiteren Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag hat wenig daran verändert.
Wohl stundenweit im Umkreis lagen die zu Altweier gehörigen Behausungen zwischen den wechselnden Hebungen und Einsenkungen des Hochgeländes verstreut, im Winter vielfach oft lange Monde durch unübersteigliche Schneewälle voneinander getrennt. Doch richtete sich der Wert der Besitzungen nicht nach ihrer Nähe oder Entfernung vom ungefähren Mittelpunkt der Ortschaft. Am weitesten von diesem gegen Westen hinaus, vom Waldrand einer schroff ansteigenden Felshalde sah unfraglich das bestgebaute und umfangreichste Gehöft des Dorfes herab; sein graues, fast plattes Dach war mit großen Steinen gegen den Sturm beschwert, und ein Zaun, aus Holzprügeln verflochten, umfriedigte das Haus. Es gehörte dem Bauern Veit oder Guy Loder, wie gewöhnlich sein Vorname nach keltischer Überlieferung geheißen wurde. Er wohnte dort mit seiner Frau, deren Taufname Tille mutmaßlich aus Ottilie verkürzt worden, beide noch ziemlich jung an Jahren, obgleich man es beiden gleich wenig ansah. Sie hausten in dem höchstbelegenen Hof Altweiers kinderlos und ohne andere Gesellschaft als diejenige eines halben Hunderts von Schafen, welche zur Winterzeit den Schutz des Gebäudes mit ihnen teilten und im Sommer zwischen den Blöcken des langgestreckten Halderückens weideten. Doch der Besitz derselben hob sie bei den denkbar einfachsten Bedürfnissen ihres Daseins an Lebensgunst über die Mehrzahl ihrer Ortsnachbarn hinaus. Der Mann schor die Wolle ab, und die Frau bereitete sie für den Händler drunten in der Stadt Markirch zu; an den hohen Festtagen des Jahres trug sie sogar ein Stück gebratenen Lammfleisches auf den Tisch. Das geschah in keinem zweiten Hause des Dorfes, wo die Insassen sich ausschließlich von Milch, Käse und Brotsuppen nährten, in die um Weihnacht, Ostern und Pfingsten ein Brocken verschnurrter Speckschwarte hineingeschnitten wurde. So lebten sie auskömmlich und sparten noch obendrein für einstige alte Tage, denn in ihrer Wandlade sammelte sich mancher Kupferheller und verwandelte sich im Gang der Jahre zu einem abgegriffenen, silbernen Batzen, sei’s mit dem unkenntlichen Bildnis von des Kaisers Majestät darauf oder aus der Prägstube der weitmächtigen Grafen von Rappoltstein und der Herren von Rathsamhausen.
Trotzdem waren Veit Loder und seine Frau nicht völlig zufrieden, aber sie redeten nicht davon. Gesprächigkeit lag überhaupt weder in ihrer Art noch in der aller sonstigen Zugehörigen des Dorfes. Doch saßen sie, zumal im Winter, vereinsamter als die anderen, und auf die Dauer ward das Geblök der Schafe im Pferch nebenan eine etwas eintönige Unterhaltung. Dann ging wohl eine Weile ein Wechselwort zwischen ihnen von den Lippen, bis sie beide gemeiniglich zugleich verstummten und, in das knatternde Herdfeuer schauend, jedes schweigsam einen Gedanken, der doch der nämliche war, für sich hinunterwürgte. Mitunter stand der Mann auch einmal plötzlich auf und tat etwas sonst wenig Bräuchliches unter seinen Stammesgenossen, indem er der Frau mit seiner derben Hand zu rauher Liebkosung übers Gesicht strich. Dann scharrte sie achtsam die Kohlen unter die Asche, um am nächsten Morgen Feuer zünden zu können, und sie gingen in ihre windumrüttelte und schneeumstarrte Schlafkammer hinüber. Aber Jahr um Jahr blieb sich’s gleich, daß keine rechte Zufriedenheit und Fröhlichkeit in ihrem Leben einkehrte.
Nun war’s ein Frühmorgen im Anfang des September. Veit Loder stand im ersten Sonnenaufgangsstrahl vor seiner Tür, über das spiegelnde Wasser im Brunnentrog gebückt, und verkürzte sich mit einer Schafwollschere die blondwirbeligen Haare. Seine Frau kam hinzu und sagte: “Schneidst dir am Freitag die Haar, willst, daß sie dir ausfallen?” Er antwortete: “Tut man’s am Freitag, wachsen sie lang,” und klippte die widerspenstigen Struppen ab. Sie tupfte mit dem Finger auf die Stirn: “Weiß es längst, bist da nicht – Freitag ist ein Unglückstag.” – “Freitag ist ein Glückstag,” erwiderte er, “zumal heut, denn ‘s ist unserer lieben Frau Geburtstag.” – “‘s ist der Tag, an dem sie unseren Heiland gekreuziget haben,” entgegnete Tille Loder, und er sagte: “Wenn du’s anders willst, ist’s Freias Tag, die Saaten- und Kindersegen bringt.”
Es war ein alter Widerspruch zwischen ihnen, aber das letzte war ein übles, unbedachtes Wort. Die Frau versetzte nichts darauf, doch drückte sie ihre weiße Zahnreihe scharf in die Lippe; erst als er hinzufügte: “Am Freitag muß man bei Sonnenaufgang ins Feld gehen, dem bleibt’s Zipperlein aus dem Fuß,” da stieß sie unmutig heraus: “Bist ein Narr – hab nicht verspürt, daß du Freias Segen ins Haus gebracht. Lauf ins nasse Gras vom Wetter heut Nacht, was Du heimbringst, geschieht dir recht!” Und verdrossen nahm sie einen Stecken und trieb die blökend sich um sie drängenden Schafe nach ihren Weideplätzen zu.
Der Himmel lag über allem mit köstlicher, wolkenloser Bläue. Fern drunten im Osten schimmerte in Duft und Glimmer das Rheintal, wie eine graue Nebelbank stieg jenseits das Schwarzwaldgebirge drüben auf; nach Westen aber sah benachbart der Doppelgipfel des Brüschbückels, den die Welschen drüben in Lothringen Bressoir benannten, über den noch sommergrünen, morgenfrischen Waldgürtel. Im Beginn der Nacht war ein wildes Unwetter durch die Berge des Wasichin gegangen, davon hingen noch helle Tropfen an den Blättern und Halmen. Aber wohin die Sonne voll und warm ihren Glanz warf, trank sie dieselben schnell auf, als habe sie mit durstenden Lippen darauf gewartet.
Veit Loder hatte die Welt oftmals so gesehen und er fand nichts Besonderes daran. Der Gedanke, daß es schön sei, war ihm noch nie gekommen, und so verfiel er auch heute nicht darauf. Nur daß seine Frau mit der Nässe recht gehabt, ließ sich nicht verkennen, denn das triefende Gekraut wusch ihm die Beine bis zu den Knieen hinan. Doch gerade deshalb kehrte er nicht um, sondern stieg weiter aufwärts. Er war auch mißmutig und wollte auf seiner Rechthaberei stehen, es sei gut und heilsam, am Freitagmorgen beim Sonnenaufgang durch Wald und Busch zu laufen. So stapfte er, wenn’s ihm gleich kein Vergnügen machte, gewohnheitsmäßig weiter; Dorn, und Nesseln bekümmerten ihn nicht, seine Waden waren hart und gefühllos, wie aus Holzknorren geschnitten, und nicht minder derbdrähtig seine Nervenstränge in Leib und Kopf.
….