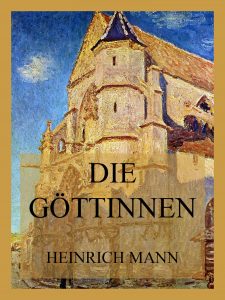Die Göttinnen oder die drei Romane der Herzogin von Assy – Heinrich Mann
Heinrich Mann verfasste sein Werk “Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy” in den Jahren 1900 bis 1902. Es besteht aus den drei Einzelromanen “Diana”, “Minerva” und “Venus”, jeweils benannt nach den römischen weiblichen Gottheiten. Die Handlung ist weitestgehend in Italien angesiedelt und spielt hauptsächlich in den großen Städten Rom, Venedig und Neapel, beziehungsweise deren Umgebung.
Format: Taschenbuch/eBook.
Die Göttinnen oder die drei Romane der Herzogin von Assy.
ISBN Taschenbuch: 9783849668372
ISBN eBook: 9783849660048
Auszug aus dem Text:
Im Juli des Jahres 1876 war die europäische Presse voll von den Reizen und den Taten der Herzogin Violante von Assy. Sie hieß “ein hocharistokratisches Rasseweib mit pikanten Launen im schönen Köpfchen, deren politische Abenteuer die Geschichte verzeichne, ohne sie ernst zu nehmen”.
Es wäre unbillig gewesen, sie ernst zu nehmen, da sie erfolglos verlaufen waren. Ehemals als eine der stolzesten Erscheinungen der internationalen hohen Gesellschaft bekannt, war die Herzogin neuerdings auf den Gedanken verfallen, im Königreiche Dalmatien, ihrem Heimatslande, eine Revolution anzuzetteln. Die Schlussszene dieses romantischen Komplotts, die misslungene Verhaftung der Herzogin und ihre Flucht ging durch alle Blätter.
Um Mitternacht, die Stunde der Verschwörer, ist im Palais Assy, an der Piazza della Colonna zu Zara, eine glänzende Gesellschaft versammelt. Das Entscheidende soll geschehen; alle der kühnen Frau Ergebenen treten ihr in letzter Stunde unter die Augen; Würdenträger, die Sitz und Stimme im Rat der neuen Königin erhoffen, zwanzigjährige Lieutenants, die um einen Blick aus ihren Augen, ihre Laufbahn und ihr Leben wagen. Der Marchese di San Bacco ist herbeigeeilt, der alte Garibaldiner, ohne den in keinem der fünf Weltteile konspiriert werden kann. Auch fehlt nicht das Faktotum der Herzogin, der Baron Christian Rustschuk, mehrfach getauft und obendrein mit dem Freiherrntitel geschmückt.
Sie selbst verzieht noch, alle suchen sie mit den Augen. Man tritt von der Tür in zwei Reihen zurück, die erregten Flüstergespräche schweigen. Da erscheint sie, ein Hochruf will losbrechen. Aber sie steht im — Hemd und lächelt. Man drängt, murmelt, reißt die Augen auf. Die Verwegensten, Unbedingtesten der Getreuen wollen alles übersehen: aber es ist ein Nachthemd, — bis über die Füße wallend und mit Point d’Angleterre reich behangen, aber doch ein Nachthemd.
Plötzlich sinkt es. Ein Herr wehrt erschrocken mit der Hand ab, mehrere Damen kreischen leise. Es gleitet über die Büste zurück: ein Augenblick hoher Spannung, die Herzogin steht in Balltoilette und lächelt. Sie tritt über das Hemd weg, das jemand fortträgt, sie beginnt zu sprechen, es ist nichts geschehen.
Ein Brief wird ihr gebracht. Sie liest ihn und wirft ihn, mit dem Fuß stampfend, den Nächsten zu. Ihr Intimer, der temperamentvolle Volkstribun Pavic oder Pavese schreibt ihr, es sei alles verloren und schleunige Flucht geboten. Er erwarte sie am Hafen.
Sie zieht sich zurück. Ein Offizier, den Helm auf dem Kopf, betritt den Saal: “Im Namen des Königs.” Er sieht sich um, er wird mit Fragen umringt, er weist den Haftbefehl vor. Gegenüber steckt die Herzogin, im Nachthemd, den Kopf zur Tür herein. Der Oberst erschrickt und salutiert. “Ich bin nicht wohl,” sagt sie, “ich habe mich zurückgezogen. Wollen Sie mir erlauben, mich anzukleiden? Eine halbe Stunde?” Gleich darauf drängen aus allen Gemächern die Gäste ins Treppenhaus. Eine Dame in gelber Atlasrobe, den Spitzenschleier übers Gesicht gezogen, bricht draußen in Lachen aus. Ein Haufe von Herren umsteht sie eng bei jedem ihrer Schritte. Sie wird in einen Wagen gehoben. Wie die Pferde schon anziehen, winkt sie aus dem Fenster dem keuchenden Rustschuk zu: “Adieu, Hausjud’!” — und fährt im Galopp davon.
Schloss Assy, wo sie groß ward, stand einen Büchsenschuss vor der Küste im Meer, auf zwei durch einen schmalen Kanal getrennten Felsen. Aus diesen Riffen schien es erwachsen, grau und zackig wie sie. Kein Vorbeifahrender sah, wo Fels und Mauerwerk sich schieden. Aber an den düster gehäuften Steinmassen entlang schwebte etwas Weißes: eine kleine weiße Gestalt schmiegte sich an den vordersten der vier eckigen Türme. Sie bewegte sich über einer Galerie spitzer Klippen, zierlich und sicher auf dem schmalen Steig zwischen der Mauer und dem Abgrund. Die Schiffer kannten sie, und auch das Kind erkannte jeden in der Weite, an seiner Tracht, am Anstrich und Segelwerk seiner Barke. Der Mann im Turban, der über seinen schwarzen Bart strich, während er sich fernher verneigte, sie erwartete ihn seit acht Tagen: er kam jeden dritten Monat daher, sein Boot tanzte, es trug nur Schwämme. Jener mit Faltenhose und roter Zipfelmütze hatte ein gelbes Segel mit drei Flicken. Aber der dort zog, wie er näher trieb, den braunen Mantel bis über den Kopfbund hinauf: er hielt das Weiße da oben für die Mora, die Hexe, die an den Felsen in Höhlen wohnte und Schuhe aus Menschenadern trug. Der Teufel flog, anzusehen wie ein Schmetterling, aus ihr heraus und fraß Herzen aus Brüsten. Durch die Vertraulichkeit einer Kammerfrau hatte Violante von dieser Sage erfahren; sie lächelte erstaunt, so oft ein unverständliches Wesen ihr begegnete, das daran glaubte. Und indes der Scirocco mit Toben die Wogen bis zu ihrem verwitterten, durchnässten Bollwerk hinauf und ihr vor die Füße peitschte, träumte das Kind in unsicheren Bildern voller Fragen von den fernen fremden Schicksalen der Schatten, die hinter einem Schleier von Gischt, still und zögernd, an ihr vorüberglitten.
Zuweilen überraschte ihren einsamen Kindersinn eine Herrinnenlaune: sie befahl ihr Gesinde in den Wappensaal. Er ruhte, ungeheuer lang, mit zertretenen Fliesen und brauner Balkendecke, die sich senkte, über der Tiefe zwischen den beiden Felsriffen, die das Schloss trugen. Unter den Füßen fühlte man das Meer sich wälzen; das Meer schien, stahlgrau in schwüler Nebelsonne, an drei Seiten zu neun Fenstern herein. Auf der vierten Seite sanken die gewirkten Stoffe von der Mauer, die Türen knarrten im Zugwind, über ihren Simsen hingen schief und geborsten die Wappenschilds, ein weißer Greif vor einem halboffenen Tor, in schwarz-blauem Felde. Jemand räusperte sich, dann verstummten alle. Vor dem spitz bedachten Kamin stand der Schlossvogt, ein Buckliger, der mit großen Schlüsseln klapperte und den wichtigsten, den Schlüssel zum Brunnen, auch im Schlaf nicht losließ. Drüben ängstigte ein winziger Gänsejunge sich vor dem starren Holzbild des Herrn Guy von Assy, vor dem braunen Rot hoch oben auf seinen entfleischten Wangen und vor dem eisernen Blick unter seinem schwarzen Helm. Wie ein weißer Turm reckte sich in der Mitte der riesige Koch. Die Schaffnerin mit Flügelhaube und Spitzbauch lugte hinter ihm heraus, und links und rechts entwickelte sich die bunt geordnete Reihe der Zofen, Lakaien, Küchenmägde und Viehdirnen, der Knechte, Wäscherinnen und Gondolieri, Violante raffte ihr langes Seidenkleidchen zusammen, die Schnur kleiner Türkise klimperte in der Stille auf ihren schwarzen Locken; und sie ging mit anmutigen festen Schritten über den wankenden Boden, an wackelnden Weiblein und geblähten Tressendienern vorbei, die ehrerbietige und groteske Flucht des Hofstaates entlang, der nur für sie arbeitete und nur vor ihr zitterte. Sie tippte dem Koch mit dem Fächer auf den Wanst und belobte ihn für seine mit Marzipan gefüllten Pfirsiche. Sie fragte einen Lakaien, was er eigentlich tue, sie sehe ihn nie. Zu einem Mädchen sagte sie gnädig: “Du bist eine gute Dienerin,” — ohne dass jene wusste, warum.
Das Meer ward still; dann ließ sie sich nach dem Festlande übersetzen. Ein Stück Pinienwald, unter dem Schutze des Schlosses stehen geblieben, führte zu bebuschten Hügeln; sie umschlossen einen kleinen See. Platanen und Pappeln krönten ihn spärlich, seltene Weiden neigten sich hinein, doch wanderte das Kind wie im dichten Walde unter den Sträuchern, unter Wacholder mit großen Beeren und Erdbeerbäumen voll hellroter klebriger Früchte. Von einer leeren Wiese fielen fette gelbe Wiederscheine auf den stillen Spiegel. In der feuchten Tiefe erstarb das Himmelsblau. Dicht beim Ufer türmten sich im grünen Wasser große grüne Steine, und Silberfische schwammen umher in diesen schweigsamen Palästen. Über einen steinernen Brückenbogen ging es zu einer schmalen Insel, darauf erhob sich das weiße Gartenhaus, im Schmuck seiner Rosetten und flachen Pilaster von buntem Marmor. Drinnen barsten die schlanken Säulchen, die rosigen Muscheln füllte Staub, die Trumeaus erblindeten unter ihren Kränzen aus Porzellan.
Ein lautes Krachen kam aus der Ecke, wo die Bergère von Rosenholz stand. Das Kind erschrak nicht, es lehnte an Sommermittagen den Kopf ins Kissen und erwiderte das Lächeln zweier heiterer Bildnisse. Die Dame hatte eine milchweiße Haut, verblichen violette Bänder lagen in der weichen Senkung zwischen Schulter und Brust und im graublonden Haar, eine schwarze Fliege hatte sich schelmisch in den Winkel ihres blassen Mündchens gesetzt. Ihr koketter, zärtlicher Hals wendete sich nach dem seidenen rosigen Kavalier, der jene Dame hier so lieb gehabt haben sollte. Er war gepudert, auf der geschürzten Lippe saß ihm ein dunkles Bärtchen. Violante wusste viel von ihm: es war Pierluigi von Assy. In Turin, Warschau, Wien und Neapel hatte er Allianzen vertändelt und Hose entzweit. Die Königin von Polen war ihm hold, er brachte ihretwegen fünf Schlachtschitzen um und ward halb tot gestochen. Wo er vorbeikam, da klingelte Gold in hellen Haufen. War es zu Ende, so verstand er neues zu machen. Sein Leben war voll von Flitter, Intrigen, Duellen und verliebten Frauen. Er diente der Republik Venedig; sie ernannte ihn zu ihrem Proveditor für Dalmatien, und er regierte das Land wie die glückliche Cythere: unter Rosengewinden, mit erhobenem Kelchglas, und den Arm um jene milchweiße Schulter. Er starb unter Scherzen, höflich, nachsichtig mit den Sünden der andern und zur Reue über die eigenen nicht geneigt.
Auch Sansone von Assy stand in Diensten der Republik, als ihr General. Für eine kunstreich gegossene Kanone mit zwei Löwen darauf verkaufte er die Stadt Bergamo dem König von Frankreich. Dann eroberte er sie zurück, weil er auch den Gießer haben wollte, der drinnen saß. Aber die Erstürmung kostete ihn zu viele von seinen teuer bezahlten, reich und schön gerüsteten Soldaten; im Zorn ließ er die Kanone einschmelzen und den Künstler aufhängen. Eine goldene Pallas Athene stand auf seinem Helm, aus seinem Brustpanzer sprang grässlich schreiend ein Medusenhaupt. Sein Leben war erfüllt von purpurnen Zelten auf verbrannten Feldern, den Fackelzügen nackter Knaben, und Marmorbildern, besprengt mit Blut. Er starb stehend, eine Kugel in der Seite, und auf den Lippen einen horazischen Vers.
Guy und Gautier von Assy verließen die Normandie, sie zogen aus zur Eroberung des heiligen Grabes. Durch ihr Leben wälzten sich Massen zerstückelter Leiber, verzerrter Häupter in Turbanen, bleicher Frauen mit flehend emporgehaltenen Säuglingen, in weißen Städten, die schaudernd hinabblickten auf blutgerötete Meere. Ihre Seele atmete in lichten Wolken, ihre eisernen Füße traten auf menschliche Gedärme. Sie sahen brünstige Sultaninnen sich winden und dachten an ein keusches Kind mit fest geschlossenem Munde, das zu Hause wartete. Auf dem Heimweg, prunkend mit den Fürstentiteln von Fabelreichen, und ohne einen Heller, und mit ausgezehrten Gliedern, erfuhren sie, dass es dasselbe Kind war, an das sie beide dachten. Darum erschlug Guy seinen Bruder Gautier. Er baute auf den Riffen im Meer sein Schloss und starb als Pirat, angesichts einer Übermacht krummer Säbel, die ihn nicht erreichten; denn sein Schiffbrannte.
Aus dem tiefsten Dunkel der Zeiten schien geisterweiß bis in die Träumerei der kleinen Violante hinein eine Halbgottmaske: das steinerne Antlitz ihres ersten Ahnen, jenes Björn Jernside, der von Norden kam. Kräftige Tränke, die seine Mutter ihm eingab, machten aus ihm einen Bären mit eiserner Seite, der in Frankreich den Seinigen Land nahm und an Spaniens und Italiens Küsten den Christen und den Muselmännern das Andenken einbrannte an heidnische Riesen voll Tücke und mit schicksalsschweren Händen. Er ankerte im ligurischen Meer vor einer Stadt, die ihm stark schien. Deshalb schickte er Boten hinein an Graf und Bischof: er sei ihr Freund, er wolle sich taufen lassen und im Dom begraben werden, denn er liege todkrank. Die dummen Christen tauften ihn. Der Trauerzug der Seinigen trug den Toten zur Kathedrale. Da sprang er aus dem Sarge, aus den Mänteln flogen Schwerter, es begann ein fröhliches Gemetzel unter den entsetzten Christenlämmern. Aber als Björn der Herr war, sagte man ihm zu seinem Schmerz, dass es nicht Rom sei, das er unterworfen habe. Er hatte Rom erobern und sich krönen lassen wollen zum Herrscher aller Welt. Nun zerstörte seine enttäuschte Sehnsucht die arme Stadt Luna so furchtbar, wie er Rom zerstört haben würde, wenn er es gefunden hätte. Er suchte es lange. Und er starb, niemand wusste wie und wo: unter zufälligen Rächerhieben, während einer Kirchenschändung oder beim Plündern eines Hühnerhofs, vielleicht im Straßengraben, und vielleicht entrückt und unsichtbar emporgehoben zu den Asen, den heiligen Vätern der Assy.
So wie diese Fünf, waren alle Assy über die Erde geschritten. Sie alle waren Menschen der Entzweiung, der Schwärmerei, des Raubes und der heißen, plötzlichen Liebe. Ihre festen Burgen standen in Frankreich, in Italien, auf Sizilien und in Dalmatien. Überall empfanden die Schwachen, das weiche und feige Volk, ihre lachende Grausamkeit und ihre harte, fremde Verachtung. Unter ihresgleichen bewährten sie sich opfermütig, ehrfürchtig, zartsinnig und dankbar. Sie waren unbedenkliche Abenteurer wie der Libertin Pierluigi, stolz und dürstend nach Größe gleich Simson dem Condottiere, blutbefleckte Halluzinierte wie Guy und Gautier die Kreuzfahrer, und wie der Heide Björn Jernside so frei und unverwundbar.
Dem Heere von Männern und Frauen, die in tausend Jahren den Namen Assy getragen hatten, folgten nur noch drei Nachzügler, der Herzog und sein jüngerer Bruder, der Graf, mit einem Töchterchen, Violante. Das Kind wusste von seinem Vater nichts weiter, als dass er irgendwo in der Welt lebe. Der arme Graf war ein Verschwender, er vergeudete die Reste seines Vermögens ganz ohne Rücksicht auf die Zukunft des jungen Mädchens. Er ließ sie an seiner Verschwendung teilnehmen, er ließ das einsame Kind im schrankenlosen Luxus eines fürstlichen Haushaltes aufwachsen: das beschwichtigte sein Gewissen. Übrigens baute er auf den Familiensinn des unverheirateten Herzogs.
Violante sah den Vater nur einmal im Jahr. Ihre Mutter hatte sie nie gekannt, doch brachte er immer eine Mama mit, jedes Mal eine andere. Im Laufe der Zeit zogen blonde und braune Mamas an dem Kinde vorüber, magere und sehr dicke; Mamas, die sie zwei Sekunden lang durch ein Lorgnon betrachteten und weitergingen, und andere Mamas, die anfangs beinahe schüchtern schienen und am Ende ihres Aufenthaltes fast zu Spielgefährtinnen geworden waren.
Das Kind gewöhnte sich, den Mamas mit leisem Spott zu begegnen. Warum führte der Papa sie her? Sie überlegte:
“Zur Schwester möchte ich keine von ihnen.”
“Aber auch nicht als Kammerfrau,” setzte sie hinzu.
Mit dreizehn Jahren erkundigte sie sich: “Papa, warum bringst du immer nur eine mit?”
Der Graf lachte; er fragte:
“Weißt du noch, die bunten Scheiben?”
Die Mama des vorigen Sommers hatte die Sucht gehabt, überall farbige Gläser einsetzen zu lassen. Sie musste das Meer rosig sehen und den Himmel gelb.
“Es war eine gute Person,” sagte Violante.
Plötzlich reckte sie sich stocksteif, tat ein paar vor Vornehmheit behinderte Schritte und führte mit lächerlich gespreizten Fingern das Spitzentuch an den Mund.
“Das war vor drei Jahren. Die Feine, weißt du.”
Graf Assy krümmte sich. Er machte sich, zusammen mit seinem Kinde, über die Mamas lustig, doch immer nur über die der vergangenen Jahre, niemals über die gegenwärtige. Er versäumte nie, nachzuforschen, ob die Kleine mit ihren Dienern zufrieden sei.
“Das Schlimmste,” so betonte er, “wäre, wenn einer es an Ehrerbietung gegen dich fehlen ließe. Ich würde ihn schwer bestrafen.”
Er zog ernsthaft die Brauen empor.
“Nötigenfalls würde ich ihm den Kopf abschlagen lassen.”
Es war seine Absicht, dem Kinde eine möglichst hohe Achtung vor der eigenen Person beizubringen, und es gelang ihm. Violante verachtete nicht einmal; es kam ihr niemals der Gedanke, dass außer ihr etwas Nennenswertes vorhanden sein könne. Welchem Lande gehörte sie an? Welchem Volke? Welchem Stande? Wo war ihre Familie? Wo ihre Liebe, und wo ein mitschlagendes Herz? Auf keine dieser Fragen hätte sie eine Antwort gewusst. Ihre natürlichste Überzeugung war, dass sie einzig, dem Rest der Menschheit unzugänglich, und unfähig sich ihm zu nähern sei. Draußen sollten die Türken gehaust haben. Auch gab es keine Assy mehr. Es lohnte sich nicht der Mühe, hinauszulugen zwischen den Gitterstäben des verschlossenen Gartens, worin sie weilte. In ihrem Kinderhirn herrschte eine verständige Resignation. Allem Geheimnisvollen, allem was sich versteckte, brachte sie eine gleichmütige Ironie entgegen: den Mamas von unbekannter Herkunft und Daseinsberechtigung, und auch demjenigen, den ihre Gouvernante den lieben Gott nannte. Die Gouvernante war eine flüchtige Deutsche, die lieber mit einem schönen Lakaien aus dem Hause lief, als dass sie lässig von biblischen Geschichten erzählte. Violante suchte den alten Franzosen auf, der in einem Turmzimmer unter Büchern saß. Er trug die Haube des Alten von Ferney, einen bunten Schlafrock voll von Schnupftabak, und machte den Essai sur les Mœurs zur Grundlage von Violantes Weltanschauung.
“Die christliche Religion ist zweifellos göttlich, da trotz allen Unsinns, den sie enthält, so viele an sie geglaubt haben,” so lautete die Apologie des Christentums durch Monsieur Henry. Über wichtige Fragen, wie die Auferstehung, äußerte er sich nur indirekt, mit boshafter Hinterhältigkeit.
“Der Heilige Geist,” sagte er, “lässt sich, um überflüssige Worte zu sparen, zuweilen herbei, die Vorurteile des Volkes gutzuheißen. Der Heiland selbst bemerkt, dass das Korn in der Erde verwesen muss, damit es reif werden kann, und Sankt Paulus schreibt an die Korinther: ,Ihr Unverständigen, wisst ihr nicht, dass das Korn sterben muss, um wieder lebendig zu werden?’ Heute weiß man wohl, dass das Korn in der Erde weder verwest noch stirbt, um darauf wieder aufzustehen; wenn es verwesen würde, stände es sicher nicht wieder auf…”
Nach diesen Worten machte Monsieur Henry eine Pause, kniff die Lippen zusammen und sah seine Schülerin scharf an.
“Aber damals,” so setzte er mit sachlicher Ruhe hinzu, “befand man sich in diesem Irrtum.”
In solchen Gesprächen bildeten sich Violantes religiöse Meinungen.
“Das Land ist von den Türken verwüstet?” fragte sie.
“Das sagt das Volk. Man findet diese irrige Meinung in sogenannten Volksliedern ausgesprochen, einfältigen Machwerken ganz ohne Kunst … Wollen Sie wissen, wer es verwüstet hat? Dummheit, Aberglaube und Trägheit, die geistigen Türken und unerbittlichen Feinde des menschlichen Fortschritts.”
“Aber als Pierluigi von Assy Proveditor für Dalmatien war, da haben die Dinge sicher anders gestanden. Und die Republik Venedig, die ist nun auch verschwunden? Wer hat sie vernichtet?”
Der alte Franzose wies mit dem Finger auf seine Brust:
“Wir.”
…..