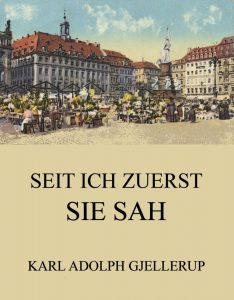Seit ich zuerst sie sah – Karl Gjellerup
In diesem weitgehend autobiographischen Roman beschreibt der dänische Literaturnobelpreisträger des Jahres 1917 seine eigene Romanze mit Eugenia Bendix, einer gebürtigen Dresdnerin.
Format: eBook
Seit ich zuerst sie sah.
ISBN eBook: 9783849655495.
Auszug aus dem Text:
Das Semester am Polytechnikum war ziemlich anstrengend gewesen, und es begann in Dresden unleidlich heiß zu werden. Außerdem wohnte ich in einer der kleineren Straßen der Altstadt, die zwar reinlich und nett, aber nicht besonders luftig sind. Oft überkam mich ein verzehrendes Heimweh nach dem dänischen Sund. Wie schön auch die Abende an der Elbe waren, sie brachten doch nur geringe Abkühlung, und wenn man sich zwischen neun und zehn Uhr auf die Brühlsche Terrasse hinaufschleppte, um dort Luft zu schnappen, zeigte das Thermometer noch seine 25 – 26 Grad Reaumur. Dies war insofern tröstlich, als es einem ein unbestreitbares Recht zum Schwitzen gab und es verzeihlich erscheinen ließ, wenn man eine Portion Eis vor dem kleinen Café Torniamenti genoß, wo es sich so angenehm zwischen den Säulen sitzen ließ, während man Bruchstücken des Konzertes vom »Wienergarten« jenseits des Flusses lauschte.
An einem solchen Abend faßte ich den kühnen Entschluß, die nahe bevorstehenden Sommerferien irgendwo in den Bergen zuzubringen. Mir selbst wenigstens kam dieser Entschluß ziemlich dreist vor, da ich sowohl genötigt als gewohnt war, mich einzuschränken. Am meisten lockte mich die Sächsische Schweiz, und noch war der letzte Eisrest mir kaum im Munde zerschmolzen, als ich mich schon für das kleine Rathen entschieden hatte. Von diesem beliebten Orte war mir ein verlockend idyllischer Eindruck geblieben, obgleich ich, wie die meisten Reisenden, das Dörfchen nur beim Hinuntergehen von der Bastei im Halbdunkel gesehen hatte.
Ein paar Tage später stieg ich gegen Mittag an der kleinen Haltestelle aus und ging zwischen den Obstgärten Oberrathens nach der Fähre hinunter. Das gegenüberliegende Felsenufer hat als einzigen Durchbruch das enge Tal, in dem der eigentliche Ort Rathen eingebettet liegt. Das Dorf zeigt fast nur seine beiden Gasthöfe, den neuen kahlen und den alten überwachsenen, zu beiden Seiten des Baches gelegen, der blinkend in den vorbeiströmenden Fluß mündet. Links erheben sich die blaugrauen senkrechten Felsen der Bastei, deren Fuß von Nadelwald und Laubbestand verdeckt ist. In der Ferne leuchten die großen Sandsteinbrüche, die schönsten im ganzen Lande. Von diesen hohen, gelblichen Wandflächen sind einige mehrere hundert Meter hoch. Zur anderen Seite hin durchschneiden sie anhaltend die Hügelreihe, auf deren Waldwellen der Lilienstein gleich einem ungeheuren Panzerschiffe dahinfährt.
Schräg, wie ein Hund läuft, setzt die Fähre über den Fluß, der sie selber vorwärtstrieb; denn sie war an einer Tonne befestigt, die ein Stück weiter oben wippte, und der Fährmann brauchte bloß ab und zu die Kette, die durch eine Winde oben an dem kleinen Maste lief, straff anzuziehen. Trotz dieser leichten Arbeit trocknete er sich fortwährend mit dem Hemdärmel die Schweißtropfen vom Gesicht, das so sonnenverbrannt war, daß er unserer Vorstellung von einer Rothaut bedeutend näherkam als irgendeiner der Sioux-Indianer, die ich am vorhergehenden Abend im zoologischen Garten gesehen hatte. Aber hier, mitten in seinem Reich, war es kein Wunder. Das blinkende Wasser ringsum schien keine Kühlung, sondern nur Sonnenhitze zu verbreiten, und der ganze Bogen des Flußufers mit seinen vielen nackten Felswänden öffnete sich gegen Süden wie ein Hohlspiegel, dessen Brennpunkt genau vor Rathen fällt. Der Fährmann stimmte mir bei, daß ich mir keinen frischen Aufenthaltsort ausgesucht hätte. Aber es war ja nicht weit nach den kühlen Gründen. Und außerdem, wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt habe, komme ich nicht so leicht wieder davon ab. Kann auch sein, daß diesmal das Schicksal seine Hand mit im Spiele hatte; die Sache erwies sich wenigstens als wichtig genug dazu. Übrigens war nicht die Hitze schuld, wenn ich später bereute, daß ich mich nicht hatte abschrecken lassen. Und habe ich es denn je bereut? Noch heutigentags – es ist jetzt fünf Jahre her – bin ich nicht imstande, diese Frage zu beantworten.
Irgendein Dichter – es ist gewiß ein sehr berühmter – hat einmal gesagt, daß nichts so schmerzlich sei, als im Elend der glücklichen Tage zu gedenken. Ich darf ihm natürlich nicht widersprechen, besonders da die Worte so oft angeführt werden, daß sie beinahe der ganzen Welt gehören; mich jedoch will es bedünken, als ob das Elend noch schwerer zu ertragen wäre ohne die Erinnerung an ein Glück. Und so will ich denn, so gut ich kann, versuchen, mich in jene Rathener Tage und in die darauffolgenden zurückzuversetzen.
Es zeigte sich sogleich, daß es nicht leicht war, ein Unterkommen zu finden. In den beiden Gasthöfen waren nur noch die schlechtesten Zimmer zu ziemlich hohen Preisen frei. Ich wurde von Pontius zu Pilatus geschickt und mußte unzählige Male über den kleinen Bach und die kleinen Leiterstufen hinan – vom Schuhmacher auf der einen Seite zum Bäcker auf der anderen, wieder hinüber zum Nachtwächter und zurück zum Krämer steigen: entweder war das Zimmer vermietet, oder es waren zwei zusammen, die mir zu kostspielig waren. Schließlich blieb mir nur noch das Schulhaus als letzte Hoffnung. Es lag weit hinten im Dorfe, wo der Fichtenwald anfing.
Es war keine Schulzeit. Ich klopfte deshalb getrost an die Tür der Lehrerwohnung. Ein kleiner Junge öffnete. Er wußte nicht, ob der Lehrer zu Hause sei, verschwand für einen Augenblick und stürzte dann an mir vorbei die Treppe hinauf, um mit einem Paar Stiefel in der Hand zurückzukehren; danach rannte er noch einmal fort und kam mit einem Rocke zum Vorschein. Bald darauf zeigte sich der Schullehrer, mit den erwähnten Kleidungsstücken angetan und mit einem schläfrigen Lächeln auf seinem offenen, gutmütigen Gesicht. Er hatte auch wirklich zwei Zimmer übrig, aber er vermietete sie nur im ganzen für fünfzig Mark den Monat. Enttäuscht bedauerte ich, ihn unnütz bemüht zu haben, er aber tröstete mich damit, daß ich sicher ein einzelnes Zimmer in der neuen Pensionsvilla nebenan bekäme. Die Villa, der ich mich jetzt näherte, sah sehr vornehm aus mit den grünen, zurückgeschlagenen Fensterläden, den Spalieren und der bewachsenen Loggia. Sie lag etwas hoch, und der Garten, den ich nun betrat, stieg mit seinen kiesbestreuten Wegen zwischen blühendem Gebüsch terrassenförmig den Berg hinan. So anziehend das Ganze auch war, wirkte es doch abschreckend auf einen armen Polytechniker. Trotzdem beschloß ich, das kleinste Dachstübchen, was es auch koste, zu mieten, wenn dieses Prachthaus mich überhaupt aufnehmen wollte; denn ich hatte das Umherlaufen herzlich satt.
Eine Gesellschaft von Herren und Damen zeigte sich unterdessen in der Loggia. Abschreckend! Ich fühlte mich fast erleichtert, als ein Dienstmädchen mir, allerdings in etwas spöttischer und überlegener Weise, aus meiner Verlegenheit half: nein, hier würden keine Zimmer vermietet; das Haus, das ich suche, könne ich ganz da oben sehen. Es war bisher von der schönen Villa verdeckt gewesen und nahm sich nicht sonderlich einladend aus, als es jetzt dahinter auftauchte und sich gegen den blauen Himmel in schamloser Nacktheit zeigte. Auch nicht der kleinste Strauch war in der Nähe; es sah so abstoßend neu aus, als ob es nie bewohnt werden könnte. Ich mußte wieder in das Tal hinab, zweimal über den Bach und über verschiedene Leitern und Steintreppen anderthalbhundert Fuß bis zur ganzen Höhe des Hügels hinaufklettern.
In der Nähe sah das Haus nicht viel wohnlicher aus: Schutthaufen, Steinabfälle und Bretter lagen ringsum verstreut; den meisten Fenstern fehlten noch Rahmen und Scheiben. Drinnen zog es abscheulich, Türen flogen zu, und vom Keller hörte man eine grobe Weiberstimme, die verschwenderisch mit den langatmigen Flüchen umging, an welchen das vulgäre Deutsch so reich ist. Ein Mann tonte, offenbar zum erstenmal, die Steintreppe; ein junges Mädchen, das im Flur den Boden scheuerte, wandte sich bei meinem Kommen um; ich sah in ein hübsches, blasses Gesicht mit einem roten Fleck auf der einen Wange. Als ich nach den Wirtsleuten fragte, lief sie schnell davon und lief in den Keller. Bald kehrte sie mit einer vierschrötigen Weibsperson zurück, deren breiter Mund offenbar das Ausgangstor der erwähnten Flüche gewesen war und deren große Tatze, die sie an der Schürze abtrocknete, ich sogleich in Verdacht hatte, in naher Berührung mit der geröteten Wange des Mädchens gewesen zu sein. Unter dem aufgeschürzten Rocke sah man ihre nackten krummen Beine mit flachen, gleichsam ausgetretenen Füßen.
»Na, der Herr will wohl ein Zimmer mieten?« sagte sie, »ja, dann wird es wahrhaftig Zeit, denn es ist nur noch eins da – wenn es ein einzelnes sein soll … Na, mach, daß du fertig wirst, dummes Ding! Willst du etwa den Herrn rumführen? … Es ist oben, zwei Treppen, bitte.«
Wir betraten ein recht geräumiges Zimmer. Hell und namentlich luftig genug, denn die Fensterscheiben waren nicht eingesetzt und die Rahmen noch nicht einmal gestrichen. Dagegen waren die feucht aussehenden Wände mit einer grauen Papiertapete bekleidet. Es schien mir auch, als ob es trotz der Luftigkeit moderig röche.
Ehe ich indessen eine Bemerkung darüber machen konnte, begann sie, die Vorzüge des Zimmers zu rühmen und zu erzählen, wie zufrieden die früheren Mieter gewesen seien – obwohl jeder sehen konnte, daß das Haus noch nie bewohnt gewesen war. Ich fragte nach dem Preise; er war ungefähr zehn Mark höher, als ich gehen wollte. Sie schwor darauf, daß es ein Spottpreis sei, nicht teurer als anderswo, obwohl alles hier oben viel besser sei: Es gebe hier weder Nebel wie unten an der Elbe, noch sei es so schwül wie im Tale; man genieße die reinste Schweizer Luft und habe eine Aussicht wie an keiner anderen Stelle; und dann seien auch die herrlichen, schattigen Promenaden da, die zum Hause gehörten und in denen die Mieter umherspazieren könnten, wenn sie nicht weiter gehen wollten. Auf diese »Promenaden« kam sie fortwährend zurück, indem sie, um ihre großartige Ausdehnung anzudeuten, mit ihren schmutzigen Händen in der Luft herumfuchtelte und beständig die Worte »da’rim und dort’nim« wiederholte.
…..