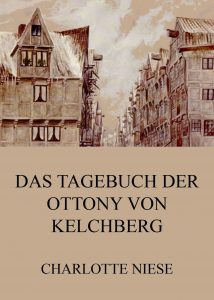Das Tagebuch der Ottony von Kelchberg – Charlotte Niese
Eine historische Erzählung in Tagebuchform aus den Tagen der deutschen Revolution. Bevorzugte Themen der auf Fehmarn geborenen Autorin waren Jugend- und Mädchenromane mit stark romantischem Einschlag, aber auch historische Reisebeschreibungen.
Format: eBook
Das Tagebuch der Ottony von Kelchberg.
ISBN eBook: 9783849656676.
Auszug aus dem Text:
Im Monat Juni 1789.
Die Demoiselle Kuntze hat sich in den Ehestand begeben, und Tante Amelie kann keine Lehrerin für mich ausfindig machen. Daher hat sie mir befohlen, jeden Tag ein weniges aufzuschreiben von dem, das ich erlebe. Sie sagt, daß solche Beschäftigung niemals schaden kann, und daß ich ohne Furcht meine Gedanken dem Papier anvertrauen solle, da sie meine Aufzeichnungen nicht lesen werde. Dies glaube ich von der Tante, da sie sehr aufrichtig und gut ist. Weil ich sie liebe, will ich also mit ihr zuerst beginnen. Tante Amelie heißt Fräulein von Montmédy und ist im Rheinlande zu Haus. Die Burg ihrer Väter ist leider zerstört, und sie hat wenig irdische Güter, daher sie das Anerbieten des Fräuleins von Ahlefeld angenommen hat, bei ihr in der kleinen Stadt Plön zu wohnen, in der besagtem Fräulein Ahlefeld ein Haus eignet.
Fräulein Ahlefeld und meine Tante haben sich irgendwo draußen im Reiche kennen gelernt, auf einer Reise; nun haben sie sich sehr lieb und wollen sich ungern wieder trennen. Zuerst war meine Tante zu stolz, alles von der Freundin annehmen zu wollen, dann aber schrieb sie an ihren Bruder in Paris, und dieser sendet ihr jetzt immer eine kleine Rente, so daß sie etwas für sich allein hat und mich zu sich nehmen konnte, als die guten Nonnen von Bacharach schrieben, sie könnten mich nicht mehr behalten. Meine Eltern, der Baron Kelchberg und seine Gemahlin, eine Montmédy, sind nämlich lange tot, und einige Verwandte, die nicht recht wußten, wohin mit mir, schickten mich ins Kloster, wo die guten Nonnen sehr lieb an mir handelten, wenn sie auch manchmal über meinen weltlichen Sinn seufzten. Wenn ich gewollt hätte, würden sie vielleicht ein Nönnchen aus mir gemacht haben, aber zum beständigen Beten hatte ich keine Lust; und dann war ich auch sehr arm. Die Nönnchen aber wollen doch eine Aussteuer für die, die sich dem heiligen Berufe widmen möchten. Dann lachte ich auch einmal über des Beichtvaters rote Nase: genug, ich bin mit einem reisenden Kaufmann, der nach Hamburg fuhr, in diese Stadt gesandt worden, und von dort hat mich Mosjöh Fuchs nach Plön gebracht.
Mosjöh Fuchs ist Peters Vater, und Peter fragte mich gestern, ob ich ihn nicht heiraten wollte. Ich war abweisend; denn erstens bin ich erst eben vierzehn Jahre alt, und Peter ist sechzehn, und dann würde ich auch nicht gern eine Madame Fuchs werden. Bin ich doch eine Baronesse Kelchberg und habe einen reinen Stammbaum. Peter lachte, als ich ihm dies erwiderte. Er sagte, daß ich blutarm wäre und mich freuen müßte, überhaupt einen Mann zu bekommen; und dann wollte er auch sehen, ein berühmter Mann und sehr vornehm zu werden.
»Es wird bald Krieg geben, und dann werde ich General oder gar ein Herzog!«
So prahlte er, und ich mußte lachen. Wer keine Ahnen hat, der wird kein Fürst, und es ist überall tiefer Frieden.
»Mein Vater sagt, die Welt ist unruhig,« schwatzte Peter weiter. »Da ist mein Onkel in Frankreich – er nennt sich Renard und wohnt in der Weinstadt Rheims. Der schrieb neulich einen langen Brief, und der Vater machte ein sehr nachdenkliches Gesicht dazu!«
Hier konnte ich ihm nun entgegnen, daß mein Onkel, der Marquis von Montmédy, der in Paris in der Nähe des Königs wohnt, meiner Tante gleichfalls einen Brief geschrieben habe, und daß darin nur von Vergnügen stand und davon, daß das Leben noch angenehmer sein würde, wenn es nicht Zwicken im Bein und Gliederschmerzen gäbe.
Da wandte sich Peter von mir ab, nannte mich eine dumme Liese und ging in seinen Garten. Ich bin ihm böse, denn ein adliges Fräulein ist keine dumme Liese, und ich will lange nicht mit ihm reden. Ihn auch nicht heiraten, was für ihn eine zu große Ehre wäre.
Sein Garten liegt dicht neben dem unsrigen. Es stehen Obstbäume darin, die im Frühjahr herrlich blühten, und jetzt schimmern die Beete rot von Erdbeeren. Wir haben keine, und wenn ich gut Freund mit Peter bin, dann krieche ich durch die Hecke und pflücke so viele Früchte, wie ich nur essen mag, aber wenn ich ihm böse bin, dann will ich ihm diesen Gefallen nicht tun. Denn es ist doch eine Ehre für seine Erdbeeren, wenn ein adliges Fräulein sie gern essen mag.
Andern Tags.
Tante Amelie rief mich, und ich mußte mit ihr ein Kleid betrachten, das ihr gehört und das für mich geändert werden soll. Es ist hellbraun mit kleinen schwarzen Punkten darin, und ich finde es sehr greulich. Aber ich darf nichts sagen, da ich sonst keine neue Robe erhalten würde. Das geht nicht, da ich doch auch manchmal aufs Schloß geladen werde, wo der Herzog Peter wohnt. Denn es gibt hier wirklich ein Schloß, das auf einem Hügelchen liegt, und darinnen wohnt der Herzog. Er ist aus dem fürstlichen Hause Oldenburg und ein sehr guter Mann. Aber Peter Fuchs behauptet, daß er keinen ordentlichen Verstand hätte und deshalb hier nach Plön geschickt wäre, wo er keinen Schaden stiften kann. »Aber,« setzte der dumme Junge hinzu, »die Fürsten haben meistens keinen Verstand, und das schadet nichts. Dann richten sie weniger Unheil an.«
Er berichtete, daß der König, der über Holstein regiert – er wohnt in Kopenhagen – auch keinen Verstand hätte, und daß sein Sohn für ihn regieren müßte.
Solche Reden liebe ich nun nicht, denn ich weiß, daß Peter gewöhnlich hinzusetzen wird: »Der Adel ist meistens auch dumm, und deshalb muß er abgeschafft werden!« Über diesen Punkt erzürne ich mich immer mit Peter. Aus ihm spricht nur der Neid, weil er kein Adliger ist – aber wenn ich dies sage, wird er böse, wie ich zornig werde, und wir nehmen uns immer vor, nie mehr miteinander zu sprechen. Dann tun wirs am anderen Tage wieder. Ich aber nur, weil ich sonst keinen Menschen habe, mit dem ich mich unterhalten könnte. Dieses aber behalte ich natürlich für mich.
Mein braunes Kleid ist von der Nähterin fertig gemacht worden und nicht so schlimm, wie ich fürchtete. Ich habe noch ein weißes Fichu dazu erhalten, und als wir am Nachmittage aufs Schloß zur Kartenpartie gingen, stand ich eine Weile vor dem Spiegel. Ich habe blonde Haare, eine weiße Haut und hellbraune Augen. Meine Nase ist ein wenig gebogen, und mein Mund ist klein. Peter Fuchs stand plötzlich hinter mir und lachte über mich.
»Du Hast ein zu spitzes Kinn!« sagte er, »und deine Ohren sind zu rot!«
Was nur daher kam, weil ich überhaupt errötete. Mit unbescheidenen Menschen umzugehen, ist sehr schwer, und ich sagte es ihm ordentlich, worauf er nur die Achseln zuckte und mir einen Brief für Tante Amelie gab, den sein Vater für sie aus Hamburg mitgebracht hatte.
Aber Tante Amelie fand keine Zeit zum Lesen, weil der Kammerherr von Treusch gerade in die Tür trat und fragte, ob er die Damen aufs Schloß begleiten dürfte. Meine Tante wurde rot, sagte aber, daß sie die liebenswürdige Gesellschaft mit Vergnügen annähme, und Peter stieß mich so in die Seite, daß ich beinahe »Au!« geschrien hätte. Aber ich tat es nicht, weil ich innerlich lachen mußte. Diese zwei alten Leute, der Kammerherr und meine Tante, lieben sich nämlich. Er ist vierzig und sie achtunddreißig; beide sollten mit dem Leben abgeschlossen haben, aber Peter sagt, daß sie sich heiraten würden, wenn sie die Mittel dazu hätten. Er hat einmal im Schloßpark hinter den Bäumen gestanden und gehört, wie die zwei von ihrer großen Liebe gesprochen, aber auch geseufzt haben, daß sie sich ohne Heiraten weiter lieben wollten. Peter sagt, daß diese Unterhaltung beinahe rührend gewesen wäre, ich aber finde es nicht rührend, wenn alte Leute verrückte Gedanken haben. Und wenn ich den Kammerherrn jetzt sehe, finde ich ihn töricht.
Jetzt also ist die Tante mit ihm voran durch die enge Straße dem Schloßberg zu gegangen und Peter mit mir hinterher. Denn es ist schrecklich zu berichten, aber Mosjöh Fuchs mit seinem Sohn werden auch vom Herzog nachmittags zur Spielpartie geladen, obwohl sie nicht hoffähig sind.
Peter lachte wieder unangenehm, als ich ihm zuerst mein Erstaunen über diese Sonderbarkeit ausdrückte, und erwiderte, daß sein Papa dem Herzog Geld liehe und für seine fürstliche Gnaden eine viel wichtigere Persönlichkeit wäre als zum Beispiel eine gewisse Ottony von Kelchberg. Nun sage ich nichts mehr und finde mich seufzend in die rauhen Sitten eines barbarischen Landes.
….