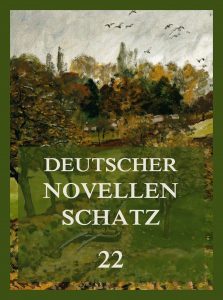Deutscher Novellenschatz, Band 22
Der “Deutsche Novellenschatz” ist eine Sammlung der wichtigsten deutschen Novellen, die Paul Heyse und Hermann Kurz in den 1870er Jahren erwählt und verlegt haben, und die in vielerlei Auflagen in insgesamt 24 Bänden erschien. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden in dieser Edition die sehr alten Texte insofern überarbeitet, dass ein Großteil der Worte und Begriffe der heute gültigen Rechtschreibung entspricht. Dies ist Band 22 von 24. Enthalten sind die Novellen: Andolt, Ernst [d. i. Bernhard Abeken]: Eine Nacht. Wild, Hermine [d. i. Adele Wesemael]: Eure Wege sind nicht meine Wege.
Format: eBook/Taschenbuch
Deutscher Novellenschatz, Band 22.
ISBN eBook: 9783849661304
ISBN Taschenbuch: 9783849666842
Auszug aus dem Text:
Es mochte gegen das Ende des vergangenen Jahrhunderts sein; die Französische Revolution, deren furchtbarer Ausbruch nur wenige Jahre danach erfolgte, kündigte schon hier und da durch verlängerte Stöße der unterwühlten Gesellschaft ihre Annäherung an; da kehrte Graf Tornstein auf seine Güter nach Deutschland zurück. Fast ein Fremdling kehrte er dahin zurück; als junger Mann hatte er die Heimat verlassen, sich seitdem bald hier, bald dort im Auslande aufgehalten, und nachdem er an den lockeren Sitten seiner Zeit den gehörigen Anteil genommen, sich in Paris mit einem französischen Fräulein vermählt, das, reich an Ahnen und arm an anderen Gütern, ihm nichts zubrachte, als die Verbindung mit einer alten, angesehenen Familie und ihre eigene ungewöhnliche Schönheit. Von dieser Schönheit hatten die Insassen des Gutes durch den Verwalter gehört, der einst, Geschäfte halber, nach Paris gerast war und den Grafen einen glücklichen Mann pries. Wieder waren Jahre verstrichen, den alten Mann deckte die Erde, und ein andrer Verwalter nahm seine Stelle ein. Die junge, schöne Gräfin, sagte ein Gerücht, hatte ein früher Tod von der Seite ihres Gatten gerissen, und vom Grafen kam noch immer keine Kunde. Er lebte in der Erinnerung seiner Untertanen ein schattenhaftes Leben, das nur manchmal von Seiten des Verwalters durch besonders empfindliche Eintreibung grundherrlicher Gerechtsame aufgefrischt ward. Da sprach man denn von ihm als von einem ziemlich leichtsinnigen, ein wenig zum Stolz geneigten, im Ganzen aber freundlichen und milden Herrn, auf den man einst große Hoffnungen gesetzt und dessen Rückkehr man herbeiwünschte, ohne daran zu glauben, weil man in ihr die einzige Schranke für die oft unausstehliche Tyrannei der Beamten sah. Und nun war er wirklich gekommen, fast unerwartet, und Alt und Jung war herbeigelaufen, sich an seinem Anblick zu erfreuen, und Alt und Jung schüttelte die Köpfe über die Verschiedenheit zwischen dem Grafen, den sie geträumt, und demjenigen, den sie nun sahen. Es kehrte zurück ein gebrochener Mann, vor der Zeit gealtert und die in früher Jugend so mutig erhobene Stirn von einem finstern Ernst umwölkt, der jede Freude ob seiner Rückkehr schnell verstummen hieß.
Der Tod seiner Gemahlin habe ihn so geändert, sagte man sich. Er habe vergebens auf Reisen Zerstreuung für seinen Schmerz gesucht; noch jetzt könne er ihren Namen nicht aussprechen hören, und keine Frau habe seit ihrem Verluste einen Eindruck auf ihn gemacht. Die Bauern schüttelten die Kopfe dazu; Sentimentalität ist auf dem Dorfe wenig zu Hause; sie waren froh, dass der Gram seine Gerechtigkeit und Einsicht nicht getrübt, die Plackereien der Beamten hatten ein Ende, mehr verlangten sie nicht. Doch Liebe und Vertrauen erwarb sich bei ihnen der kalte, schroffe Gebieter nicht, dessen Stolz durch sein Unglück nur gewachsen schien. Ein freundliches Gesicht hatte ihm mehr Herzen gewonnen, als alle seine wirklichen Eigenschaften es vermochten. Nur die Frauen waren mildern Sinnes, sie bedauerten ihn, um die verstorbene Gräfin, die solche Liebe eingeflößt, galt unter ihnen, trotz ihres Todes, für eine hochbeglückte Frau. Zwei Kinder hatten ihn begleitet; der Knabe mit seinem deutschen Namen Otto, war des Vaters Ebenbild, das Mädchen französisch Leonie genannt, und beide einander so unähnlich, als es Bruder und Schwester nur je gewesen sind, doch beide schon, scheu und fremd, denen das deutsche Wort nur gebrochen von den weichen Lippen floss.
Dieser letzte Umstand änderte sich jedoch bald, und dadurch fiel die eine Scheidewand zwischen dem Dorfe und dem gräflichen Hause weg. Denn trotz seines Stolzes, duldete der Graf, dass seine Kinder sich in ungestörter Freiheit mit den Kindern der Bauern herumtrieben. Sie hatten freilich auch keinen anderen Umgang. Ihr Vater schloss sich von dem benachbarten Adel, der ihm zuerst freundlich entgegenkam, so viel als möglich ab; man hielt seine Absonderung für Teilnahme an den neufranzösischen Ideen, er wurde auch in diesen Kreisen unlieb, und so stand er bald ganz allein.
Bei dieser Abgeschlossenheit befanden sich die Kinder ganz wohl. Mit Büchern und Anstandsvorschriften wurden sie wenig geplagt. Ihr Unterricht beschränkte sich auf das, was sie vom Schulmeister und vom Pfarrer lernen konnten, woran sich für Leonie ein besonderer Cursus in kleinen Handarbeiten und sonstigen weiblichen Beschäftigungen unter den Augen der Frau Pfarrerin schloss.
Wir können nicht sagen, das unsere kleine Heldin diesen Arbeiten besonders geneigt war; sie liebte den Musikgang, sie liebte überhaupt Alles, was ihre kleine Person mit Behaglichkeit umgab, und nur wenn sich mit einer Beschäftigung irgendein Zweck, ein Interesse verband, verwandelte sich oft plötzlich ihre träge Natur in starre Unermüdlichkeit und seltene Energie. Die Pfarrerin selbst war eine gute, sanfte Frau, die das mutterlose Mädchen seiner Mutterlosigkeit wegen schnell lieb gewann und, da sie selbst keine Kinder hatte, es gerne um sich sah; und Leonie war gerne dort, denn sie fühlte sich geliebt. Lieber aber war sie noch, wo es minder ruhig herging, denn, ohne selbst lärmend zu sein, war sie doch die Seele von allem Lärm, und die Knaben des Dorfes, ihr Bruder nicht ausgenommen, dem sie an geistiger Gewandtheit weit vorausgeeilt war, erkannten sie stillschweigend als ihre Herrscherin an. Unter ihnen war sie in ihrem Elemente, von ihnen wurde dem kleinen Fräulein die erste Huldigung dargebracht, und wunderbar war es, wie ihre zierliche Erscheinung sich immer sauber herausschälte aus der rohen Atmosphäre, in der sie sich so wohl gefiel.
Bei Otto drohte der Bauerntölpel mit der Zeit den adeligen Junker ganz zu überwuchern, bei Leonie war das unmöglich. Ihre ganze Organisation widersetzte sich dem. Sie war und blieb ein kleines, feines Ding, das nirgends viel Platz einnahm, geräuschlos auftrat und immer da war, man wusste nicht wie. Alles war Widerspruch an ihr; ihre blonden, lockigen, etwas ins Rötliche schimmernden Haare umrahmten seltsam den zarten Kopf mit den schwarzen, denkenden Augen. Statt des weichen Gemütes, das ihrem Bruder bei den tollsten Streichen stets den Stempel kindlicher Liebenswürdigkeit verlieh, zeigten sich bei ihr nur kurze, seltene Aufwallungen voll Leidenschaft, die aber der nächste Augenblick spurlos zu verwischen schien. Bis jetzt war eine zähe Beharrlichkeit, die vor keinem Hindernis zurückschrak, vielleicht einer der deutlichsten Züge dieses keimenden, sonderbar schwer zu erkennenden Charakters. Wohin kein Fuß gekommen, da drang gewiss der ihrige durch. Fest wie Stahl und leicht wie eine Feder, hatte ein Tanzmeister von ihr gerühmt; die Bauern druckten sich minder kunstgemäß aus, zollten ihr aber nicht geringere Bewunderung. Und es war ein eigener Anblick, sie so geschmeidig und luftig in ihrer unbändigen Gesellschaft durch Flur und Felder streifen zu sehen. Wie eine verzauberte Prinzessin-Tochter von bösen Kobolden bewacht, nur dass die Kobolde hier mehr gehorchten als befahlen, und selbst Otto entzog sich diesem Zauber seiner Schwester nicht. Aber keck und mutig in dem kleinen Kreise, in welchem sie Königin war, wurde sie scheu und still, sobald sie vor ihrem Vater stand. Er war ihre einzige, aber auch ihre große Furcht. Wann diese Furcht angefangen, darüber hatte sie nicht nachgedacht; es war ein Zustand, der für sie in der Ordnung der Welt begriffen war. Nie hatte sie ein freundliches Wort von ihm vernommen, nie einen Blick, eine Liebkosung von ihm empfangen, wie sie Otto, trotz seines finsteren Wesens, doch oft von ihm empfing; ja ihre aufkeimende Lieblichkeit, die, wechselvoll wie die Welle, in allen Schattierungen quellenden Lebens unaufhörlich ging und kam, immer dieselbe und doch stets eine andere schien, weckte bei ihm, anstatt Stolz und Befriedigung, offenbar nur eine größere Strenge und eine Kälte, die fast an Abneigung stieß. Doch ruhten seine Augen oft eigentümlich forschend auf ihr, als suche er ein Rätsel zu lösen, das seinen peinlichsten Anstrengungen stets von neuem zu entschlüpfen schien. In diesem Blicke vielleicht lag der erste Grund der Scheu, die Leonie vor ihrem Vater empfand; sie hatte ihn in seiner unheimlichen Tiefe so oft auf sich geheftet gesehen! Als sie noch in den Armen ihrer Amme lag und das werdende Verständnis an den ersten schwachen Eindrücken der äußeren Welt sich allmählich zu entfalten begann, war es dieser Blick vielleicht gewesen, der an ihr zitterndes Leben trat und der klaren Welle der Empfindung eine dunklere Färbung verlieh. Wer forscht dem Keime unserer Gefühle nach? Genug, die Furcht vor ihrem Vater schien mit Leonies Lebenswurzel verwachsen zu sein, ein heimlicher Trotz gegen einen Druck, der ihr mehr willkürlich als berechtigt erschien, mischte sich nach und nach ihrer Empfindung bei; sie war verschlossen und still in seiner Gegenwart und ging ihm aus dem Wege, wenn sie ihn kommen sah. Er bemerkte es wohl, aber er rief sie nie zurück. Er glaubte sie zu kennen; vielleicht kannte er sie auch, und doch — wir möchten fast sagen, es wäre besser gewesen, er hätte sie nicht so gut gekannt.
Sie sind zu streng gegen Ihre Tochter, Herr Graf, sagte der Pfarrer eines Tages zu ihm.
Finden Sie? fragte der Graf in den Hof deutend, wo Leonie, in dem Kreise einiger jugendlichen Verehrer stehend, die ihr angeborene Anmut in unbewusster Koketterie zum Zeitvertreib an ihnen übte.
Kinderei! meinte der Pfarrer, die Achseln zuckend.
Die Zeit wird kommen, wo es keine Kinderei mehr sein wird, versetzte der Graf, was dann?
Ich begreife Sie nicht. Jeder andre Vater hätte seine Freude an dem schönen Kinde, und Sie —
Ja, sie ist schön, sagte der Graf, und eine Wolke zog über seine Stirn, ich wollte, sie wäre es nicht.
Der Pfarrer war erstaunt, schwieg aber, da er zu fühlen glaubte, dem Grafen sei das Gespräch unangenehm. Seine Verstimmung hatte überhaupt seit einiger Zeit bedeutend zugenommen. Er war offenbar unruhig, ritt einige Mal selbst nach der nächsten Stadt und unternahm endlich eine längere Reise, von der er erst nach Wochen wiederkam. Ein gewisses Befremden erregte er vorher im Dorfe, das er einen Hof, der in einiger Entfernung vom Dorfe ziemlich vereinsamt am Saume des Waldes lag und dem Schloss eigen zugehörte, einem seiner Diener in Pacht gab, dem einzigen, der ihn aus der Fremde zurück begleitet, sich durch sein mürrisches, verschlossenes Wesen wenig Liebe erwarb und dazu, obgleich ein Deutscher, doch fremd in der Ortschaft war. Wie gesagt, die Leute verwunderten sich über das Glück des Mannes, und die Gunst, in welcher er bei dem Grafen stand, erwarb ihm manchen Neider. Das kümmerte aber den Thomas Werner nicht. In aller Ruhe ließ er seine neue Behausung herrichten, wie man sagte, mehr wie es sich für ein Herrenhaus gezieme, als für einen Bauernhof. Möbel wurden aus der Stadt herbeigeschafft, die Fenster der oberen Zimmer umhüllten sich mit Gardinen, und man wollte von Teppichen wissen, deren Farbenpracht alles im Dorfe Gesehene bei weitem überstieg und sich nur mit denen des Schlosses vergleichen ließ. Das der Thomas diese Vorbereitungen nicht für sich allein traf, versteht sich von selbst; man munkelte allerhand von einer reichen Braut; als aber das Haus fix und fertig war und in all seinem Glanze dastand, kam eines Tages die alte Mutter des Thomas, die keine Seele kannte, ebenfalls aus der Fremde herbei und quartierte sich ganz still bei ihrem Sohne ein. Von einer Braut war keine Spur, weder aus dem Dorf, noch aus der Fremde; Thomas und seine Mutter lebten fast ganz allein und hielten keinen Dienstboten, als einen blöden Knecht.
Der Graf ritt hinüber und nahm Alles selbst in Augenschein. Otto bat vergebens mitgehen zu dürfen, das Gerede der Leute hatte ihn neugierig gemacht, und Thomas’ barsches Benehmen, als er einst versucht bei ihm vorzusprechen, hatte den Grafensohn arg verletzt und seine Neugierde dabei nur vermehrt. Allein sein Vater war nicht nachgiebiger gestimmt, als Thomas selbst, und wies ihn mit seiner Bitte scharf zurück. Missmutig schlich er zu seiner Schwester hinab in den Hof. Leonie saß auf einem Steine, ihre goldenen Haare leuchteten hell im blendenden Sonnenschein, die zierlichen Füßchen berührten kaum die Erde; sie sah mit den schwarzen Augen grade vor sich hinaus in die Weite und lächelte seltsam bei ihres Bruders Mitteilung. Du bist ein Narr! sagte sie nach einer kleinen Pause, und weiter sagte sie nichts. Und doch wusste Leonie besser als irgendjemand, woran sie war. Auch sie war neugierig gewesen, lange bevor noch irgendjemand es war. “Und die Hauptsache ist, das die Kinder sie nicht sehen, und niemand erfahre, wer sie ist,” hatte sie ihren Vater zu Thomas sagen hören. Leonie hatte besonders scharfe Sinne, und das Gehör stand den anderen keineswegs nach. Wer war es, den sie nicht sehen sollte? dessen Dasein der Vater so ängstlich zu verheimlichen befahl? Leonies kindische Neugierde klammerte sich an dem Gedanken fest und ließ ihn nicht mehr los. Dass Thomas den Waldhof erhielt, dass er so viele unerklärliche Vorbereitungen traf, geschah nicht ohne Grund, das sah auch sie wohl ein; Alle frugen, sie allein war still, aber ihr lärmendes Gefolge trieb sich plötzlich öfter ohne sie herum, und sie hatte ungemein viel um die neue Behausung des Thomas zu tun. Da saß sie denn eines Nachmittags im Grünen, von der dichten Hecke versteckt; im Garten arbeitete Thomas, und seine Mutter half ihm dabei.
Und sie kommt also wirklich morgen schon? fragte plötzlich die zitternde Stimme der alten Frau. Leonies Ohren öffneten sich weit in horchender Erwartung.
…