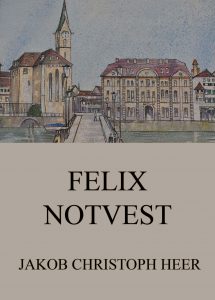Felix Notvest – Jakob Christoph Heer
Ein Schweizer Dorf muss sich den Problemen stellen, die die beginnende Industrialisierung mit sich bringt. Einer der bekanntesten, teils autobiografischen Romane des Schweizer Heimatschriftstellers.
Format: eBook
Felix Notvest.
ISBN eBook: 9783849655853.
Auszug aus dem Text:
Eine Holzbrücke schwingt sich über die Reif, den krystallklaren Fluß, der zwischen Waldhügeln hervor in die offene Thalmulde plaudert.
Sie verbindet die Abtei und das Dorf Reifenwerd.
Stimmungsreich erhebt das ehemalige Kloster seine Doppeltürme und Giebel südlich vom scheunenthorartigen Eingang der Brücke aus mächtigen Baumkronen, und neugierig ragen die leichten, spitzen Dachreiter über das unregelmäßige Viereck roter Hohlziegeldächer. Unter den weit ausgreifenden Aesten der Linden hindurch sieht man das mächtige, altersgraue Thor mit der kleinen Pförtnerei, und nur wenig zurück erhebt sich, von Strebepfeilern gestützt, die hohe, dreischiffige Kirche, ein einfacher gotischer Bau aus dem dauerhaften Grausandstein der Gegend. Ueber die Ecken der niedrigen Seitenschiffe steigen die Türme, die indessen, nur wenig über den hohen First des Mittelschiffes geführt, nicht in ihrer ursprünglichen Anlage vollendet worden sind, sondern mit Spitzhelmen abschließen, deren blau und weiß glasierte Ziegeldächer hell in die Sonne leuchten.
Aus den Quadern des einen Turmes schaut unmittelbar unter dem Helm ein stark verwittertes Bildnis, das eine Krone trägt, hinüber zur Brücke und zu der Ruine Reifenloh, einem alten Turm mit geborstenen Mauerzähnen, welcher sich auf dem Buchenhügel über der Brücke und den ersten Häusern des Dorfes erhebt. Das verwitterte Bildnis ist die »Frau von Reifenwerd«, der Volksmund sagt, es stelle Agnes, die Königin von Ungarn, dar, die bei den Dominikanerinnen des ehemaligen Klosters den Schleier genommen, es verschönert, mit Gütern bereichert, zur Abtei erhoben habe und darin in hohem Alter gestorben und begraben worden sei.
Seit langen Jahren steht das schicksalsreiche Kloster, von der Sage und Geschichte des Schweizerlandes verklärt, von den alten Linden und Weiden umschirmt, in träumerischer Oede da. Doch dient die Abteikirche den Dörflern von Reifenwerd immer noch als Gotteshaus, der Raum unter den Bäumen vor dem Thor als Kirchhof, und zwei der Klostergebäude, die nächst der Reif an die Mauer gebaute »Mühle«, ein schweres Steinhaus mit gotischen Treppengiebeln, und das hinter der Kirche liegende altertümliche Pfarrhaus, einst das kunstgeschmückte trauliche Heim der Aebtissin, sind noch bewohnt. In den anderen Räumen spinnt die Verlassenheit, und obwohl die Abtei reich an Denkmälern vergangener Zeiten ist, betritt nur selten ein Freund der Geschichte oder der kirchlichen Altertümer aus der nahen Stadt das im Jubel der Glasgemälde warm leuchtende Gotteshaus oder den Kreuzgang, wo mutige Ritter und sanfte Bräute des Himmels unter eingesunkenen Steinen der Auferstehung harren, denn nie ist die Neigung zu geschichtlichen und künstlerischen Studien im Lande geringer gewesen als jetzt. In gedeihlicher Arbeit, doch mit nüchternem Blick geht das Volk durch seine Tage und unterstützt den Wunsch der Regierung, daß die alte unnütze Abtei wieder eine Stätte nützlicher Arbeit werde.
Die dumpfe Klosterglocke läutet in den Sonntagvormittagsfrieden, der weit und breit auf der Maienlandschaft ruht.
Aus dem Klosterthor strömen die Bewohner von Reifenwerd und wandern in losen, bedächtigen Gruppen der gedeckten Brücke zu und hinüber ins Dorf, über dessen Hausdächern der Rauch in blauen Ringeln zerfließt. Die gemächlich Gehenden sind Kernvolk aus dem Bauernstamme des Landes, steif in Leinen gekleidete Leute mit derben, doch gutmütigen Gesichtern, etwas langsam und schwerfällig, aber gesättigt mit der Kraft, welche der Mensch aus der Scholle schöpft.
Die Kirchgänger sprechen wohl alle über die Predigt des jungen Pfarrverwesers, der an die Stelle des kürzlich gestorbenen Dekans getreten ist und von den Dörflern deswegen eine hoffnungsvolle Teilnahme genießt, weil er der Sohn des Antistes, des ehrwürdigen obersten Vorstehers der Landeskirche, ist.
»Gewiß, gewiß, er ist ein Feuerkopf, aber das Bauerndeutsch hat er noch nicht in seiner Gewalt — ich selbst habe ein wenig genickt und geschnarcht.«
So meint lächelnd der Kommandant, ein hagerer Fünfziger, dessen braunrotes, ehernes Gesicht aus stehendem Hemdkragen schaut, und streift mit der Hand über den ergrauenden Schnurrbart, der ihm mit der straffen Haltung das militärische Aussehen giebt.
»Der Dekan hat allerdings handfester geredet,« versetzt mühsam der breite, gebückt einherschreitende Säckelmeister, dem die mächtigen Bauernpratzen bis unter die Kniee hangen, »in das Geistliche hat der alte Herr immer etwas über die Begebenheiten im Dorf, über das Vieh und den Stand der Reben und Felder gemengt — das versteht der Verweser noch nicht.«
»Begebenheiten im Dorf,« ergreift der behäbige Hirschenwirt, in dessen aufgeblasenem Gesicht zu kleine Aeuglein stehen, das Wort. »Da find ja zwei Neuigkeiten auf einen Schlag. Der Leutnant Ruedi Fürst ist aus England zurückgekehrt — und der alte, lahme David Fürst giebt die Großratsstelle ab. Das ist wohl so gemeint, daß wir den Leutnant an seine Stelle wählen sollen.«
Die kleinen Aeuglein ermessen lauernd den Eindruck der Rede auf seine beiden Begleiter.
Im Auge des Kommandanten sprüht ein Funke auf.
»Der Leutnant soll sich keine Einbildungen machen!« grollt er scharf, »gottlob sind bei uns die Aemter noch nicht erblich. David Fürst hat wohl äußerlich stets noch zu uns Bauern gehalten, aber eine Unterlassungssünde an uns, an unseren Kindern und Kindeskindern ist es doch, daß er uns das Lehrerseminar, das in die Abtei hätte verlegt werden sollen, verloren gehen ließ. Nun hat der Staat von öffentlichen Anstalten nichts mehr zu vergeben als das Zuchthaus. Das kann uns leicht in den Garten wachsen!«
»Das Zuchthaus? Da sei Gott vor!« keucht der Säckelmeister, »nein, da müssen wir eben einen Großrat haben, der sich mit aller Macht dagegen stemmt und wehrt, vor allem nicht den Leutnant, der in den drei Jahren, die er in England gewesen ist, gewiß kein größeres Verständnis für die Bedürfnisse der Gemeinde erworben hat, aber Ihr seid der Mann, Kommandant! Ihr müßt die Last auf Euch nehmen!«
»Ich suche das Amt nicht,« erwidert der hochaufgerichtete, soldatische Bauer fast schroff, »ich meine nur, es gehöre nicht in die Familie Fürst!«
»Die Frau Kommandantin würde der Titel aber freuen, sie hat Sinn für die Ehren,« lächelt der Hirschenwirt verschmitzt, »man muß einer lieben Frau auch etwas zu Gefallen thun.«
Der Kommandant giebt sich den Anschein, als habe er die Bemerkung überhört, und die drei Männer, welche in das Dorf getreten sind, stehen plaudernd vor dem schönen altertümlichen Gasthaus zum »Hirschen«, während sich die übrigen Kirchgänger, Männer und Frauen, langsam in die Häuser zerstreuen. Wie auch Kommandant, Säckelmeister und Wirt auseinandergehen wollen und sich gemächlich »Guten Sonntag!« wünschen, hallen von der Abtei über die Reif herüber ein paar leichte Schüsse in die Stille des Dorfes, an dessen Landstraße man die drei alten steinernen Brunnen singen hört. Ein Flug Tauben stiebt über die roten Giebel des Klosters empor, und einen Augenblick spähen die Männer neugierig über den Fluß.
»Bah!« lacht der Hirschenwirt, »Sigunde Fürst schießt im Rosengarten Tauben,« der Säckelmeister aber schüttelt mißbilligend den dicken Kopf: »Am Sonntag! — Das Teufelsmädchen!«
…..