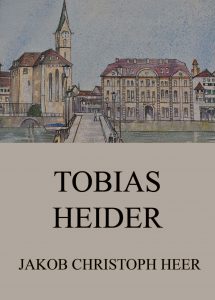Tobias Heider – Jakob Christoph Heer
Ein autobiografisch angehauchter Roman aus Heers Schweizer Heimat. Obwohl Heers Werke weitgehend als Heimatromane bezeichnet werden dürfen, übt er darin auch immer wieder Kritik am damals schon grassierenden Tourismus in seiner Schweizer Heimat.
Format: eBook
Tobias Heider.
ISBN eBook: 9783849655860.
Auszug aus dem Text:
Reifenwerd, im Frühling 1879.
Die Schmerzen und Nöte der Lehrerprüfung am Seminar sind vorüber. Nach dem richtigen Lauf der Dinge hätte ich nun schon als Vikar oder Verweser an einer Schule unterkommen sollen. Es herrscht aber im Kanton ein ziemlicher Überschuß an Lehrkräften, und mit anderen muß ich warten, bis sich mir irgend ein bescheidener Posten erschließt. Mißvergnügt blickt der Vater, Mechaniker und Werkstättenchef einer großen Maschinenfabrik, auf meine erzwungene Muße und meine vergeblichen Versuche, vorübergehend als Schreiber ein Stück Brot zu verdienen.
Gestern brach sein Zorn los: “Du weißt, ich habe es nie leiden mögen, daß du dich dem Lehrerstande zugewandt hast, und dein jetziges Herumsitzen und Nichtstun ertrage ich nicht mehr. Es ist eine Schande vor den Nachbarn und dem Dorf. Nun habe ich mich für dich auf einen Ausweg besonnen: du reisest übermorgen nach Paris, suchst dir dort ein Stück Brot und wartest ab, bis dich das Erziehungsamt ins Land zurückruft. Da hast du hundert Franken für die Reise und das erste Einleben, und im übrigen hoffe ich, gehe dein Aufenthalt ohne Zuschüsse von mir ab. Du wirst dich an das Sprichwort halten müssen: ›Friß Vogel oder stirb!‹ Reicht dir aber doch einmal das Wasser ans Kinn, so erinnere dich, daß es in der Stadt einen Telegraphen und eine Schweizer Gesandtschaft gibt – die werden mich finden!”
So hart nun die Rede des Vaters in mein Herz geklungen hatte, in der Nacht empfand ich mein neunzehnjähriges Glück: Mir erschließt sich die Welt! Ich darf reisen wie der Vater selber, wie sein junger Bruder Johannes, die beide als Maschinenbauer die Weite der Länder gesehen und mir genug von ihrer Schönheit erzählt haben.
Und nun schreibe ich mein Tagebuch schon in Paris!
Der Abschied vom Elternhaus gab sich leichter, als ich mir gedacht hatte. Die Mutter mit den warmen Braunaugen sagte einfach: “Bub, tue Recht, und wenn eine Versuchung an dich herantritt, denke an mich, wie ich dich liebe und für dich bete!” Je näher die Reisestunde heranrückte, umso milder wurde der Vater. Er begleitete mich nach St. Jakob, besorgte noch einige Anschaffungen für mich und löste mir sogar die Fahrkarte, ohne meinen Hunderter zu beanspruchen. “Möge dir also Paris die Augen öffnen, und vergiß nie, daß du einen ehrlichen Namen trägst. Darauf gibst du mir jetzt einen herzhaften Kuß!”
Ein unerhörtes Erlebnis, daß der Vater und ich uns küßten! Ich erholte mich aus meiner Verwirrung erst, als der Zug aus den Schluchten des Jura hervorglitt, bei Delle das Vaterland verließ und die Sonne als ein feuersprühendes Rad in den Ebenen Burgunds versank. In der Nacht nagte ich an einem Schinkenbein, das mir die Mutter als Wegzehrung mitgegeben hatte. Der Gedanke, der mich auf der Fahrt am stärksten bewegte, war: Um Gottes willen, wenn Paris gegen mich nur so barmherzig ist, daß ich den Vater nie um eine Unterstützung bitten muß! – Hungern? – Ja, vielleicht! Nur nicht um Geld nach Hause schreiben!
In unermeßlicher Spannung trat ich frühmorgens in das Leben der Stadt. Ich hatte schon als Seminarist so viele Schilderungen ihrer Straßen und Plätze, ihres Lebens und Treibens gelesen, daß mich ihr Lärm und Staub, die Fülle und strömende Gewalt der Bilder nicht sonderlich überraschte; ich spürte nur den mächtigen Nervenreiz, die ungemeine Lebensbejahung, die dem Neuling daraus entgegenströmen. Erst um Mittag sollte ich einen Bekannten treffen, Doktor August Ulrich aus Stein am Rhein, der es übernommen hatte, mir im Quartier Latin Wohnung zu bereiten. Was nun tun den langen Vormittag? Ich erkletterte das Dach eines Pferdebahnwagens und ließ mich im Genuß der Stadt da- und dorthin führen. Dabei erlebte ich aber eine niederschlagende Überraschung. Ich verstand den Schaffner nicht, ebensowenig die Nachbarn, die ich in ihrem Geplauder belauschen wollte, am wenigsten die paar, die mit mir selber eine Unterhaltung anzuknüpfen versuchten. Zu meinem Französisch schüttelten sie den Kopf: “Es muß eine merkwürdige Provinz sein, aus der Sie kommen!”
In der Nähe der Tuilerien beendigte ich meine Fahrten, setzte mich im Garten auf eine Bank und grübelte in einer ersten Anwandlung des Heimwehs über das Rätsel: Sieben Jahre Unterricht im Französischen, und jedes Buch liesest du sicher; aber im lebendigen Alltag stehst du da wie der Hirtenknabe vom Berge. Dir fehlen alle Kleinmünzen des tatsächlichen Lebens. Und ich soll in der Stadt ein Stück Brot verdienen, rasch, wenn möglich schon morgen!
Da gesellte sich ein alter Herr zu mir und begann ein Geplauder über die Morgenstimmung der Bäume, Blumen und Vögel. Diesen Mann verstand ich, und als er mich fragte: “Woher? – wozu?”, legte ich ihm freimütig meine Gedanken von vorhin dar. “Getrost, junger Herr!” lächelte er unter silbernem Schnurrbart hervor. “Jeder Franzose spürt doch, daß Sie es mit der Grammatik ernst genommen haben. Sie kommen unter uns schon vorwärts.” Mit einem höflichen Wort verabschiedete er sich, um seinen Spaziergang fortzusetzen; sein Gespräch war mir aber in meinem Verzweiflungsanfall eine Wohltat gewesen.
Nach und nach belebte sich der Park immer mehr mit Lustwandelnden, namentlich Erzieherinnen, die ihre Schützlinge zum Spiel ins Grüne führten. Gegen elf Uhr stieg plötzlich ein Fesselballon aus den blühenden Baumkronen gegen den blauen Himmel empor, schwebte eine Weile als graugoldige Kugel über der weiten Umgebung und wurde an einer Leine wieder zur Erde gezogen. Das Schauspiel weckte meine Neugier. Ich trat in die Einfriedigung des Luftschiffplatzes, sah, wie sich ein Strauß blühender, jubelnder Jugend emportragen ließ, und als der Ballon zum dritten Male stieg, war ich selber Gast im Korb. Wir erreichten eine Höhe, welche die Aussicht über die weite, bläulich erschimmernde Stadt freigab, über die silbernen Windungen der Seine, die Züge der Boulevards und die Menge der Quartiere. Die Fahrt erschien mir aber recht kurz, am liebsten hätte ich gleich beim folgenden Ausstieg wieder mitgetan. Ich war wohl leichtsinnig! Wie durfte ein Mensch, der vielleicht schon in ein paar Tagen nicht weiß, woher sein Brot nehmen, Ballon fahren?
Um die Mittagszeit wandte ich mich über die lehmfarbene, doch hübsch mit Schiffen belebte Seine ins Quartier Latin hinüber und suchte dort nach Verabredung meinen Heimatbekannten in einem großen Eßhaus am Boulevard Saint Michel. Ich fand ihn nicht, aber ein anderer Herr meldete mir, Doktor Ulrich habe sich gerade heute als Lehrer einer Privatschule an einem Ausflug der Zöglinge nach Saint Cloud beteiligen müssen; in Sachen meines Zimmers sei ich in einem Hotel garni beim Pantheon angemeldet. Der Herr, der mir diesen Bericht erstattete, stellte sich mir als Deutscher vor: Doktor Hans Böten aus Leipzig, Assistenzarzt irgend eines großen Hospitals. Der Blondling mit den scharfen blauen Augen unter kristallenen Brillengläsern führte mich in die Sprachgeheimnisse der französischen Küche ein. Wir speisten vortrefflich und mancherlei; ich mit dem Gedanken: So gut wirst du in Paris nur dies einzige Mal essen können. Zum Abschied sagte mir der Arzt überlegenen Tones: “Ich lade Sie ein, daß wir uns morgen Schlag neun – Sie hören: Schlag neun – an der nächsten Haltestelle der Pferdebahn treffen. Dann will ich Ihnen ein Bild aus dem Leben der Stadt zeigen, das für Sie einmal wichtig werden kann!” Was für ein Geheimnis mag sich hinter diesem Angebot verbergen? –
Die Unterkunft im Hotel garni gab sich. Ich habe im achten Stockwerk des alten Baues ein hübsches Zimmer bezogen. Bin ich die endlosen, rot angestrichenen Treppen hinaufgestiegen, und sehe ich von den wurmstichigen Möbeln und verblaßten Teppichen ab, so kann es als ein recht heimeliges Stübchen gelten. Auf seiner kleinen Vorzinne erscheine ich mir wie der Turmwart des Pantheons. Ameisenhaft wuseln die Menschen in der Tiefe über den hellen Platz hin. Nur gedämpft dringt der Lärm des Tages zu mir herauf. Meine Nachbarn sind die Schwalben des Himmels. Der Blick fliegt an der gewaltigen Kuppel des Pantheons vorbei über das Dächermeer der Stadt bis zu der geschichtlichen Windmühle auf dem Montmartre und folgt dem gewundenen Lauf der Seine, bis sie sich in fernen flimmernden Bändern verliert, und der heutige Sonnenuntergang über dämmernden Fernen war wohl einer der stärksten Eindrücke meines ersten Tages in Paris.
Nun wohnen aber auch schon die Sorgen in meinem hohen Quartier. Nachdem ich der schnurrbärtigen Wirtin die Miete auf einen Monat im voraus bezahlt hatte, erkannte ich mit Schrecken, daß meine Barschaft schon über die Hälfte hinuntergesunken war, und sagte mir: “Tobias, zu Abend gibt es Wasser und Brot!”
Ich stieg nun noch einmal in die Straßen hinunter, suchte einen Bäckerladen und fand ihn an der Rue Soufflet, die den Platz des Pantheons mit dem nahen Jardin du Luxembourg verbindet. “Jacques Vebeur” las ich und dachte: Da hat sich doch sicher ein deutscher Jakob Weber verfranzösiert. Zwei strohhaarige, sommersprossige Mädchen in blitzblanken Schürzen bedienten die Kunden, ergötzten sich an meinem ungelenken Ausdruck und sagten beim Zuwägen und Bezahlen des Brotes: “Wo kommen Sie denn her?” – “Aus der Gegend von Wülfenberg in der Schweiz,” war meine Antwort. – “Das müssen wir unserem Vater melden,” sagten sie, “er ist Elsässer, kennt aber Ihre Heimat!” Richtig, nach ein paar Augenblicken kam der behäbige Bäcker. “Ja, ja, in den ersten Monaten 1871 war ich interniert in der Schweiz und habe in Wülfenberg bei einem Bäcker Streuli manche Mulde Brot geknetet – gern: es gab dort einen Wein, der hieß Solbacher!” Jacques Vebeur schnalzte und zwinkerte wie in erfreulichem Nachgenuß, die ebenso liebenswürdigen wie häßlichen Töchter belustigten sich an ihrem Vater, fügten ein paar Kipfel zu meinem Brot – und ich weiß also, wo ich künftig in Paris meine Abendmahlzeit einzukaufen habe.
Das mein erster Tagebucheintrag aus der großen Stadt. Wie werden die folgenden lauten?
Heute morgen traf ich nach Verabredung meinen Tischbekannten von gestern. Eine lange Fahrt mit der Pferdebahn führte uns vor das Tor eines gewaltigen Hospitals, und nachdem sich der Arzt in einen weißen Kittel geworfen hatte, geleitete er mich in etliche Säle der Männer- und Frauenabteilung der Geschlechtsleidenden.
…..