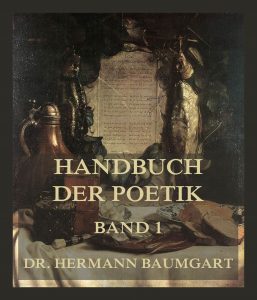Handbuch der Poetik, Band 1. Eine kritisch-theoretische Darstellung der Dichtkunst – Herman Baumgart
Das große Verdienst dieses Werkes, einer der umfassendsten Abhandlungen zur Poetik, liegt in einer gründlichen, besonnenen und fruchtbaren Kritik der Lessingschen Theorien vom aristotelischen Standpunkt aus. Der Verfasser führt namentlich aus, dass alle Kunst die Aufgabe hat, seelische Vorgänge im weitesten Sinne darstellend hervorzubringen. Der große Künstler aber ist der, dessen Empfinden zugleich das stärkste und reichste und das gesündeste ist, deshalb für die ganze Gattung gültig, einen jeden bewegend und sein persönliches Empfinden erweiternd, läuternd und zu dem allgemein menschlichen erhebend. Das Gesetz ist also ein und dasselbe für die Poesie wie für die bildenden Künste. Das Werk enthält eine Fülle von guten Beobachtungen über einzelne Dichtungen. Lob verdient u.a., daß der Verfasser auch das altdeutsche Epos in grundlegender Weise mit herangezogen hat; interessant ist es, hier die Lachmannsche Liedertheorie vom philosophischen Standpunkte aus bekämpft zu sehen. Grundlage dieses Textes, der insofern überarbeitet wurde, dass die wichtigsten Wörter und Begriffe der aktuellen Rechtschreibung entsprechen, ist die Originalausgabe aus dem Jahre 1887. Dies ist Band eins von zwei.
Format: Paperback, eBook
Handbuch der Poetik, Band 1. Eine kritisch-theoretische Darstellung der Dichtkunst.
ISBN: 97838496663614 (Paperback)
ISBN: 9783849661502 (eBook)
Auszug aus dem Text:
Mehr als ein Jahrhundert ist seit dem Erscheinen von Lessings Laokoon verflossen, ohne dass die Zeit dem Ansehen und der Bedeutung dieser Schrift etwas abzuziehen vermocht hätte. Eher könnte man, sieht man die wachsende Literatur an, die sich an den Laokoon knüpft, behaupten, dass das Interesse an den darin behandelten Problemen und namentlich an der Art ihrer Behandlung sich noch fortwährend steigert. Das könnte nicht so sein, wenn diese Streitfragen einen sicheren Abschluss gefunden hätten; stattdessen ist vielmehr unter allen Sätzen das Laokoon kaum ein einziger, der, seit Herders erstem kritischen Wäldchen bis auf den heutigen Tag, nicht fast ebenso viele Gegner als Verteidiger gefunden hätte, und zwar so, dass die Polemik nicht allein Lessings spezielle Auffassung der Laokoongruppe trifft, sondern dass die wichtigsten Resultate der Lessingschen Kunsttheorie vielfach geradezu negiert, andrerseits selbst von den Verteidigern doch nur bedingt gelten gelassen werden. Ein mit der höchsten Sorgfalt und Vollständigkeit entworfenes Bild des Standes der Frage gibt nach allen Seiten hin die zweite Auflage von Blümners Kommentar zum Laokoon.
Für alle Zeiten mustergültig ist die eben nur einem Lessing eigentümliche Methode der kritisch-polemischen Untersuchung in dem merkwürdigen Buche; hieraus zu lernen wird man so wenig aufhören, als aus dem Besten, was das Altertum uns hinterlassen hat. Umso mehr wird, sofern die Sätze des Laokoon die unbestrittene kanonische Geltung nicht mehr besitzen, die Untersuchung sich auf die Voraussetzungen zu wenden haben, von welchen Lessing darin ausgegangen ist.
Aber wo den Maßstab hernehmen, um die Kritik eines Lessing zu prüfen? Wo die Autorität finden, der selbst ihm gegenüber eine objektive und unbedingte Gültigkeit zuzuerkennen wäre?
Es gibt nur einen, dem dieses Ansehen unbestritten gebührt, und für den Lessing selbst es am nachdrücklichsten gefordert hat: Aristoteles; aber nicht allein mit seiner Poetik, sondern mit der Gesamtheit seiner Schriften, aus denen ja für jene erst das Verständnis gewonnen werden kann.
“Die Poetik des Aristoteles ist das Fundament der Lessingschen Ästhetik. Von dem Höhepunkt dieser Ästhetik, der Theorie des Tragischen, ist diese Tatsache offen daliegend; sie ist aber ebenso zweifellos in betreff des allgemeinen Aufbaues dieser Wissenschaft wie er im Laokoon vorliegt.” So schreibt W. Dilthey in einem trefflichen Aufsatz “über Gotth. Ephr. Lessing” in den Preußischen Jahrbüchern 1867, und es wird die Richtigkeit des Satzes wohl nicht bestritten werden.
Dagegen ist die folgende Stelle desselben Aufsatzes geeignet eine Reihe von Bedenken hervorzurufen: “Das Rätsel des Schönen und der Kunst ist durch drei ganz verschiedene Untersuchungsweisen in Deutschland der Erörterung unterworfen worden. Der Aristotelische Gedanke einer Technik der Künste, d. h. einer Untersuchung der Mittel, vermöge deren sie die höchsten Wirkungen hervorrufen, herrschte bei Kant. Durch Kant trat die Verfassung des produzierenden Genies selber in den Vordergrund; der tiefe Gedanke von einer besonderen Art des Genies die Welt aufzufassen ward durch ihn, Schiller und Fichte, die Romantiker und folgenden Philosophen fortgebildet und in seine historischen Konsequenzen verfolgt. Das Studium der physiologischen Bedingungen hat dann den gegenwärtigen Arbeiten ein ganz neues Fundament gegeben.”
Diese Sätze enthalten manche Unklarheit; vor allem aber muss dagegen Verwahrung eingelegt werden, dass in jenen “drei ganz verschiedenen Untersuchungsweisen” eine Steigerung enthalten sei, hinsichtlich ihrer Fähigkeit das “Rätsel des Schönen und der Kunst” zu lösen, ja dass sie in dieser Beziehung auch nur als gleichberechtigt einander koordiniert werden dürften. Eher noch möchte die Steigerung im umgekehrten Verhältnisse stattfinden. Untersuchungen über Symmetrie und Proportion, wie z. B. der empirische Erweis, dass das Verhältnis des goldenen Schnittes uns besonders wohlgefällig sei und daher überall im Kunstgewerbe eine vorzugsweise Anwendung finde, ferner über Harmonie, Farbenmodulation und Ähnliches können bis auf einen gewissen Grad den Nachweis führen, dass manches unsern Sinnen Angenehme (ἡδεῖα) sich als auf bestimmte mathematische und arithmetische Verhältnisse, auf die physikalische Natur des Klanges oder der Farbenerscheinung, zugleich auf die Physiologie unseres Organismus gegründet, als natürliches Postulat der Einrichtung unserer Sinneswerkzeuge ergibt. Aber da, wo das eigentliche Gebiet der Kunst erst beginnt, mit den ethischen Eindrücken, da also, wo es gilt, vermittelst jener angenehmen Sinneseindrücke zusammenhängende, bewusst empfundene Seelenvorgänge höherer Art, wie sie die Seele bevorzugter Menschen bewegten, nun auch in den Seelen der übrigen Menschen hervorzurufen, da hören alle Resultate jener Untersuchungsmethode längst auf. So wichtig z. B. die berühmten Helmholtzschen optischen und akustischen Entdeckungen für die Wissenschaft sind, so haben sie für die Ausübung und auch für die Betrachtung der musikalischen und malerischen Kunst doch kaum einen andern Wert als das Apercü der Pythagoräischen Zahlentheorie. Diese ganze, vielfach jetzt so hoch gepriesene Methode kann es höchstens zu äußerlichen Resultaten bringen und auch hier nur dazu, einzelne von der Praxis längst oder von jeher geübte Handgriffe und immer befolgte äußere Elementargesetze nun noch als durch die physikalische Wissenschaft bestätigt und mit physiologischen Erfahrungen in Übereinstimmung aufzuzeigen.
Auch die zweite von Dilthey namhaft gemachte “Untersuchungsweise” ist weit davon entfernt, die erste, Aristotelisch-Lessingsche zu überbieten, oder auch nur ihr gleichgestellt werden zu können. “Die Verfassung des produzierenden Genies selbst,” “der tiefe Gedanke von einer besonderen Art des Genies die Welt aufzufassen” — es ist nicht mit völliger Deutlichkeit zu erkennen, was damit für die theoretische Kunstbetrachtung spezifisch Unterscheidendes gesagt sein soll. Genies hat es zu allen Zeiten gegeben, und zu allen Zeiten hat nicht allein ein jedes seine besondere Art gehabt die Welt anzusehen und widerzuspiegeln, sondern solange es etwas Ähnliches wie Kunstbetrachtung gibt, hat sie gerade von dem Eigenartigen, welches das einzelne Genie charakteristisch in dieser Beziehung auszeichnete, ihren Anfang genommen. Dass eine räsonierende Kunstphilosophie von diesem Gesichtspunkte aus, namentlich wenn sie in historischer Überschau die Epochen und Zeitalter vergleichend ins Auge fasst, eine Menge interessanter Beobachtungen anstellen kann, ist gewiss, und von denen, die Dilthey nennt, hat Schiller hierin den schärfsten Blick und die großartigste Auffassungsweise entwickelt. Er hat auch noch mehr getan: er hat in solcher Betrachtung die Wege gefunden, “das Rätsel des Schönen und der Kunst” in seiner Lösung höchst wesentlich zu fördern. Aber wie anders konnte dies geschehen, als dass durch solche vergleichende Erforschung des Genies eben nur neues Material vermittelt wurde, Gesetze der Kunsttechnik aufzufinden, Regeln und Vorschriften für die einzelnen Künste aufzustellen; wie anders, als dass “die Mittel untersucht wurden, vermöge deren sie die höchsten Wirkungen hervorrufen,” d. h. also, wie anders als in derselben Weise, in der eben Aristoteles und Lessing die Kunst oder vielmehr die Künste untersucht haben. Und ist Lessing nicht auf demselben Wege dazu gelangt wie Schiller? Ist etwa in der Hamburgischen Dramaturgie nicht der “tiefe Gedanke” enthalten “von einer besonderen Art,” wie die französischen Tragiker und die Griechen die Welt auffassen und wie die spanischen Dramatiker und wie etwa ein Shakespeare?
Kurz, es gibt nur eine Art der Kunstbetrachtung, welche zu positiven Resultaten führt, und das ist die Aristotelisch-Lessingsche! Wie in ihr alle übrigen zusammenlaufen und sie fähig ist alle andern in sich aufzunehmen und sich dienstbar zu machen, so muss eine jede andere, sobald sie zu ihrem eigentlichen Zwecke gelangt, die Konsequenzen zu ziehen, sich ihrer bedienen. Eine Technik der Kunst aufzustellen, die Mittel ihrer höchsten Wirkung zu bezeichnen, darauf kommt alles an, und hier haben Aristoteles und Lessing für alle Zeiten das mustergültige Beispiel gegeben. Ihre Methode ist die einzig wahre und fruchtbare, unübertroffen und unvergänglich!
Jeder Versuch von einem Prinzip, einer Definition des Schönen ausgehend, die einzelnen Künste zu erforschen und ihnen Regeln zu stellen — des absolut Schönen oder wie es dem einzelnen Genie oder einzelnen Nationen und Epochen erschien — muss scheitern. Der Begriff dessen, was in den einzelnen Künsten schön sei, kann sich für die theoretische Erkenntnis umgekehrt erst aus den richtig erkannten technischen Gesetzen derselben ergeben; ja die Theorie des Schönen überhaupt wird, wenn sie nicht in subjektive und leere Abstraktionen sich verlieren oder mit einzelnen ganz allgemeinen Bestimmungen sich begnügen soll, diesen Weg einschlagen müssen. Auch das Naturschöne wird schlechterdings nicht anders theoretisch erkannt und beurteilt werden können, als indem der Umweg durch die Erkenntnis des Kunstschönen genommen wird, und nur der Überblick über die Gesamtheit der technischen Grundgesetze der einzelnen Künste wird diese Erkenntnis in ihrem vollen Umfange herbeiführen können.
Für die Begründung aber einer solchen Erkenntnis hat das Altertum und vor allen Aristoteles bei weitem mehr getan, als die neuere und neueste Kritik anerkennen will. Noch in der erwähnten zweiten Auflage seines Laokoon-Kommentars, in welchem überall das Bestreben vorwaltet den heutigen Stand der Kritik zu resümieren, findet Blümner, dass “eine wirkliche Theorie der Künste, ein ästhetisches System, wenn man es so nennen soll, niemals bei den Alten existiert hat.” “Wir sind gewöhnt,” fährt er weiterhin zur Begründung fort, “die Werke der Kunst als Schöpfungen der frei waltenden Phantasie zu betrachten; wie fremdartig muss es uns daher anmuten, wenn wir sehen, dass das gesamte Altertum, indem es die Künste als nachahmende bezeichnete, ihnen eine, wie es zunächst scheinen könnte, niedrigere Stufe anwies, sie aus dem Gebiete des Idealen in die gemeinere Sphäre der Wirklichkeit herabdrückte.” Das einzige aber, was er zur Abwehr der grob-realistischen Auffassung der Nachahmungstheorie des Aristoteles anführt, ist dieses, “dass, wenn die Alten die Künste als nachahmende bezeichnen, sie als Gegenstände der Nachahmung nicht etwa allein die Objekte der wirklichen, uns umgebenden materiellen Welt verstehen, sondern auch, ja vornehmlich jene idealen Formen, welche nicht willkürlich erfundene, abstrakte Vorstellungen sind, sondern auf der Grundlage einer ununterbrochenen lebendigen Naturanschauung beruhen.” In der umfangreichen Einleitung, in welcher Blümner die Vorgeschichte des Laokoon- Problems gibt, ist denn auch Aristoteles mit einigen wenigen, ganz allgemein gehaltenen und zwar sehr anfechtbaren Sätzen abgetan.
Eine Behauptung wie die folgende, so oft sie auch ausgesprochen und nachgeschrieben ist, sollte doch in einem so vorzüglichen Werke wie das Blümnersche keine Stelle finden: Aristoteles habe den Begriff der Nachahmung beibehalten, “weil er die psychologische Erklärung des Ursprungs der höheren Kunsttätigkeit und der Wirkungen, welche die Werke der Kunst auf die Seele ausüben, vornehmlich in der nachahmenden Natur fand. Dem Menschen ist ebenso der Trieb zum Nachahmen eingepflanzt, als die Lust am Nachgeahmten, und dies erklärt ebenso die Entstehung der nachahmenden Künste, als das Vergnügen, welches ihre Schöpfungen bereiten.” Das ist natürlich mit Berufung auf das vierte Kapitel der Poetik gesagt; aber wie kann man denn übersehen, dass in diesem Kapitel gar nicht von der künstlerischen Nachahmung die Rede ist, weder von der poetischen, noch von einer andern kunstgemäßen, sondern von den in der Natur des Menschen liegenden Ursachen (αἰτίαι φυσικαί), die als die erste Veranlassung anzusehen sind, wie er überhaupt zu einer bildnerischen — poietischen — Tätigkeit den Weg hat finden können; denen die ersten rohen und zufälligen Versuche (αὐτοσχεδιάσματα) zuzuschreiben sind, in welchen dann eine spätere Zeit die Antriebe für die allmähliche Fortentwicklung zur Kunst gefunden hat!
Mit ganz demselben Recht kann man mit dem Hinweise auf jenes vierte Kapitel und noch vielleicht auf die verwandte Stelle in der Rhetorik (Buch I. K. 11. 1371, b 4) behaupten — und leider ist ja auch dieses oft geschehen —, dass nach Aristoteles die Freude, welche die Kunst hervorbringe, auf der Erkenntnis (μανθάνειν) und der Verwunderung (θαυμάζειν) beruhe. In die empirische Aufzählung dessen, woran die Menschen sich erfreuen, wie sie an jener Stelle der Rhetorik gegeben wird, gehört auch diese Freude an der Nachahmung als solcher, an der bloßen wohlgelungenen Nachahmung, mag auch das Nachgeahmte an sich selbst unerfreulich sein; auch hatte Aristoteles gewiss recht in ihr die zweite natürliche Ursache zu finden (wie es im vierten Kapitel der Poetik geschieht), welche die primitiven Vorübungen zur Kunsttätigkeit veranlasste. Aber diese Freude geht nicht aus dem Inhalte der Nachahmung hervor, sondern aus dem bei einer jeden Nachahmung stattfindenden Schluss, “dass dieses jenes sei”, sie kann also auch wohl durch das echte Kunstwerk erregt werden, aber als eine nebensächliche und ganz untergeordnete; mit der Freude am Kunstschönen, mit der von jeder einzelnen Kunst in besonderer Weise erweckten, ihr ganz eigenen, allein durch sie bezweckten und erzeugten Freude (οἰκεία ἡδονή) hat jene nicht das Geringste zu schaffen.
…