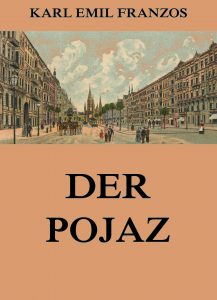Leib Weihnachtskuchen und sein Kind – Karl Emil Franzos
Leib Weihnachtskuchen ist der vielleicht bewegendste Roman des Schriftstellers Franzos. Er erzählt die Geschichte eines armen Juden aus Ostgalizien, der Heimat des Autors. Alles was er noch hat ist seine Religion – und die führt ihn unvermeidlich zu seinem tragischen Ende.
Format: eBook
Leib Weihnachtskuchen und sein Kind.
ISBN eBook: 9783849655464.
Auszug aus dem Text:
Wer im Waggon von Lemberg nach Czernowitz dahinfährt, mag leicht versucht sein, Ostgalizien für menschenärmer zu halten, als es ist. Meilenweit öde Heide oder dürftiger Ackerboden, einige Hütten in der Ferne, aber selten ein großes Dorf. Anderwärts kann der Reisende oft aus der Lage der Hütten, der Form der Gärten erkennen, wie gewalttätig die Bahnlinie hindurchgeführt worden. Hier ist dies wohl nur an einer Stelle so: wo das Dampfroß von Halicz weg, dem uralten Flecken, der dem Land den Namen gegeben hat, weiter gegen Südost eilt und die Gemarkung des Dorfes Winkowce berührt. Da sieht man zur Rechten einen stattlichen Bauernhof, schief zur Bahn gestellt, zur Linken den großen Obstgarten. Hier hat der eiserne Strang ein blühendes Anwesen entzweigeschnitten.
Der Besitzer jenes Hofs war ein ruthenischer Bauer und hieß Janko Wygoda. Das ist eigentlich ein komischer Name: »Hans Bequemlichkeit«, aber er wird keinem Landeskind so erscheinen, schon weil er überaus häufig ist. Wer das Geschick dieser armen Menschen erwägt, könnte glauben, daß dies eine Art Notbehelf ist, damit man unter ihnen doch wenigstens etwas finde, was an Wohlleben erinnert. Aber Wygoda heißt auch ein die Straße kürzender Feldweg, dessen Benutzung den Nachbarn gestattet wird; der Name haftete am Grundstück und ging, als Kaiser Josef die Familiennamen einführte, auf den Besitzer über. Freilich heißen heute, bei dem ungemeinen Niedergang dieses Bauernstandes, schon viele Hunderte so, die keinem Menschen mehr etwas zu gestatten oder zu verbieten haben.
Unser Janko Wygoda hatte es besser; er saß auf dem Erbe seiner Vorfahren, aber hart genug war es ihm geworden. Vielleicht rettete ihn nur seine Häßlichkeit vor dem Verderben. Vater und Mutter waren die lustigsten, leichtsinnigsten, durstigsten Menschen in der Gemeinde und von jenem Schlag, den man so oft in diesem reinblütigsten Slawenstamm findet, dem nur einige Tropfen Mongolenblut eingemischt sind: groß, stark, fettleibig, mit blondem Kraushaar und wasserblauen Augen. Und diesem Paar legte das Schicksal einen kleinen schwarzen Mongolen in die Wiege. Die Nachbarn lächelten, selbst der Pope unterdrückte bei der Taufe den Witz nicht, den Wurm gehörig unter Wasser zu setzen: »Das Teufelchen kann’s brauchen!« Die Mutter weinte, der Vater tröstete: »Vielleicht holt der Teufel den Wechselbalg wieder ab, und Gott schenkt uns ein christlich Kind!« Beide Wünsche erfüllten sich nicht; Janko blieb der Einzige und gedieh zu einem kräftigen, sehnigen, freilich hageren und kleingewachsenen Knaben, dem im gelblich blassen, von straffem, schwarzem Haar umstarrten Antlitz die schief geschlitzten, scheu blickenden Augen standen. Wohl das Häßlichste an diesem Antlitz war der Ausdruck dumpfen, traurigen Trotzes; selbst die Hohnreden der Nachbarn, die Schimpfworte der Mutter, die Fußtritte des Vaters hatten den Janko nicht heiterer gemacht.
Aber tüchtiger und arbeitsamer. Er hielt sich an die Knechte, weil ihn diese nicht schlugen, arbeitete rastlos auf den entlegensten Äckern, wohin der Vater nie kam. Allmählich freilich konnte er sogar den Garten am Hause betreten, ohne dem Alten zu begegnen; der hatte zuviel Geschäfte außerhalb. Des Vormittags mußte er zu einem der drei Wucherer gehen, in deren Hände er geraten war, dem Gutsherrn von Winkowce, Wladislaus von Paterski, dem armenischen Pächter der Haliczer Herrschaft, Stefan Kastanasiewicz, und dem Juden Moses Erdkugel in Halicz. Die drei Männer übten ihre Wohltaten zu demselben Zinsfuß, fünfzig, hundert und, wenn es sein konnte, zweihundert Prozent; aber nur der würdige Erdkugel war bereits wegen Wuchers bestraft. Und mit Recht, denn er hatte sein Geschäft offen betrieben und jene Rücksicht vergessen, die man befreundeten Beamten schuldet. Der Pole und der Armenier übten diese Rücksichten, und darum waren sie Ehrenmänner; auch Hritzko Wygoda ging lieber zu ihnen und zum Juden nur, wenn es sein mußte. Das war seine Arbeit am Vormittag; des Nachmittags betrank er sich in der Schenke, des Abends mußte ihn Janko mit Hilfe eines Knechts heimschleppen.
Das waren die einzigen Begegnungen zwischen Vater und Sohn, und sie liefen friedlich ab, weil der Alte besinnungslos war. Als Gast betrat Janko niemals die Schenke und war achtzehnjährig geworden, ehe der erste Tropfen Schnaps seine Lippen netzte. Auch das war gegen seinen Willen geschehen; er brach an einem glühheißen Tage vor allzu großer Anstrengung auf dem Felde zusammen; die Knechte wollten den Ohnmächtigen durch den Trunk wieder ermuntern; mehr als der brennende Geschmack brachte ihn der Abscheu vor dem wohlbekannten scharfen Duft wieder zum Bewußtsein.
Sooft er auch sein Schicksal verfluchte, für eines war er ihm dankbar: daß ihn die Eltern nie zur Schenke mitgenommen, weil sie sich seiner Häßlichkeit geschämt. Das war gut; er konnte die Wirtschaft aufrecht halten. Freilich war alles nutzlos, solange sie lebten; die Mutter ließ das Hauswesen verfallen, der Vater verkaufte die Frucht auf dem Halm und schaffte selbst das nötigste Gerät nicht an; aber sie mußten ja bei solcher Lebensführung ein frühes Ende nehmen. Er hatte sie als Kind gehaßt, solange er sie gefürchtet; als Jüngling ging er mit stumpfem Gleichmut neben ihnen her; er wünschte ihren baldigen Tod nicht, aber das mußte ja kommen, wie auf den Herbst der Winter folgt.
Und dann war er der Herr und alles gut. Daß in Wahrheit alles verloren war, daß eigentlich kein Halm mehr dem Vater gehörte, sondern jenen drei Wohltätern, wußten mehrere im Dorfe, er nicht, den es zunächst betraf. Der Vater war den Wucherern Geld schuldig, das mußte dann eben zurückgezahlt werden; Schlimmeres ahnte er nicht. Wer auch hätte es ihm sagen sollen? Er sprach mit keinem mehr als das Notwendigste, hatte keinen Freund. Die Leute verhöhnten den Wechselbalg und Duckmäuser, einige mochten das arme traurige Arbeitstier vielleicht bemitleiden, gingen ihm aber doch gern aus dem Wege. Ebenso seine Knechte; er war ja als Herr gerecht, mutete keinem so viel zu wie sich selbst, aber sie atmeten doch auf, wenn er ihnen den Rücken kehrte. Ihm jedoch waren eigentlich alle Leute im Dorfe gleichgültig, bis auf einen, den er grimmig haßte, den Pächter der Schenke, Leib Weihnachtskuchen.
Wieder ein seltsamer Name, und auch er ist nicht vereinzelt. Gleich anderen, ähnlichen Namen unter den Juden des Landes erklärt er sich daraus, daß die Beamten, die sie ihnen aufnötigten, witzige Herren waren. Aber dem Großvater des Leib tat der Name schwerlich wehe, und auch er selbst hatte größere Sorgen. Ein kleines, armseliges, verknittertes Stückchen Menschheit, das immer mit einer scheuen, demütig fragenden Miene umherschlich, als wollte es die Leute anflehen: Nicht wahr, du hast doch nichts dagegen, daß Leib Weihnachtskuchen lebt?! Kein Schenkwirt in Podolien nimmt es seinen Gästen übel, wenn sie ihn »jüdisches Hundsblut« nennen und an den Wangenlöckchen zerren; Leib ließ sich, wenn’s sein mußte, noch ganz anderes gefallen. Aber dazu kam es selten; im Gegenteil, er wurde von seinen Gästen besser behandelt als die meisten andern Wirte. Erstlich hatten sie Mitleid mit dem kränklichen Männchen; ferner war zum Neid kein Grund; er war so arm wie kein Knecht in Winkowce und hungerte mit Weib und Kind öfter, als er satt wurde. Denn wohl ging die Pacht auf seinen Namen, aber Herr Paterski, dem die Schenke gehörte, hatte »aus Barmherzigkeit« auf die Kaution verzichtet, Moses Erdkugel die Vorräte angeschafft, und nun hielten ihn die beiden für immer in den Krallen. Endlich aber war der Mensch so dumm; wäre er kein Jude gewesen, sie hätten ihn für ehrlich gehalten; er wässerte den Schnaps nicht, gebrauchte keine doppelte Kreide, munterte niemand zum Trinken auf, und wenn ihn jemand um Vermittlung eines Darlehens bei seinen eigenen Wohltätern ersuchte, mahnte er – bei Hritzko war’s freilich vergeblich gewesen – – gar davon ab. Nein, dem Leib taten sie nichts.
Nur Janko haßte ihn glühend, weil sich ihm in dem kleinen Menschen die beiden Verderber seiner Eltern verkörperten, der Schnaps und der Wucher. Leib wußte dies, und wenn der Jüngling des Abends die Schenkstube betrat, den Trunkenen zu holen, schlich er nach scheuem Gruß in die Ecke und wich ihm auf der Straße weit aus. Einmal aber war kein Platz dazu, und das sollte ihm schlecht bekommen.
Auf jener Wygoda war’s, von welcher der Name der Familie rührte, und an einem kalten, nebligen Novembertag. Zähneklappernd eilte der Kleine in seinem dünnen, geflickten Kaftan den schmalen Steg dahin, der über einen künstlich erhöhten Damm führte; rechts und links waren sumpfige Wiesen, die nur im Hochsommer zur Weide dienten, nun aber unter Wasser standen, über das der erste Frost eine dünne Eisdecke gelegt. Da tauchten aus dem Nebel die Umrisse eines Menschen, der ihm entgegenkam; er erkannte seinen Todfeind und blieb zitternd stehen. »Aus dem Weg!« rief der Janko, »für Juden ist die Wygoda nicht geöffnet!« – und er hob die Faust. Leib wollte dem Hieb ausweichen, strauchelte dabei und kollerte den Abhang hinab, die Eisdecke brach unter ihm. »Hilfe!« schrie er in Todesangst auf. Aber Janko ging weiter, einem Hund hätte er herausgeholfen, dem Leib nicht. »Hilfe!« klang es noch einmal, schon schwächer; der Bursche hielt an, sein Herz begann zu pochen, dann setzte er seinen Weg fort. Ertrinken wird er nicht, dachte er, dazu ist das Wasser zu seicht! Und wenn auch – hab ich ihn hineingeworfen?! Aber das Herz schlug ihm nun so arg an die Rippen, daß er doch nach einer Weile anhalten mußte.
…..