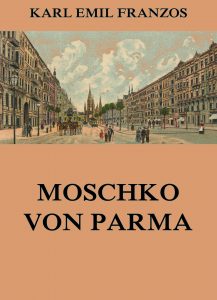Moschko von Parma – Karl Emil Franzos
Moschko ist ein Jude aus Barnow und Soldat mit Leib und Seele. Als er aber eines Tages aus dem gerade zu Ende gegangenen Krieg zurückkehrt, beginnt er vieles zu bereuen …
Format: eBook
Moschko von Parma.
ISBN eBook: 9783849655402
Auszug aus dem Text:
Was in diesem Buche erzählt werden soll, ist nur der Lebenslauf eines armen, verschollenen Menschen, welcher in einem entlegenen Winkel der Erde geboren wurde und nach mancherlei Fahrten und Schicksalen daselbst verstarb, einsam und elend, wie er gelebt. Mit seinem Familiennamen hieß er Veilchenduft, mit dem Vornamen aber nacheinander Mosche, Moschko, Moses, Moriz, Moschko und endlich wieder Mosche. Die Geschichte dieser wechselnden Namen ist zugleich die Geschichte von allem Glück und Unglück seines Lebens, welches man hier ausführlich und der Wahrheit gemäß berichtet findet, von der Wiege bis zum Grabe.
Mitten im Judenviertel von Barnow war er geboren, in einem jener kleinen, düsteren, sumpfigen Sackgäßchen, welche um die alte »Betschul« liegen, und zwar in der kleinsten, schmutzigsten Hütte dieses ärmlichen Gäßchens. In dieser Hütte wohnte sein Vater, Abraham Veilchenduft, welcher nicht weniger als vier Gewerbe betrieb – er wirkte als Schulklopfer, Krankenpfleger, Totenwächter und Schneider – und dennoch häufig, um nicht zu verhungern, genötigt war, zu einem fünften zu greifen: zum Betteln. Denn jene vier Gewerbe bringen, in Barnow wenigstens, nicht viel ein, auch wenn man die seltene Vielseitigkeit hat, sie vereinigt zu betreiben. Als Schulklopfer hatte Abraham ein Gehalt jährlicher zwölf Gulden und mußte hierfür die Betschul in Ordnung halten, viele gottesdienstliche Verrichtungen erfüllen und die ganze Gemeinde zu gewisser Zeit, welche just in den kältesten Winter fällt, im Morgengrauen zum Schulgang wecken. Freilich pflegte er daneben auch Kranke und wachte bei Toten, aber wenn er sich sogar dabei zuweilen ebensoviel verdiente, so sind doch zwei Gulden monatlichen Einkommens nicht viel, wenn man ein Weib und sechs Kinder zu ernähren hat. Denn das war der einzige Reichtum in der armseligen Hütte: drei Knaben und drei Mädchen. Was aber die Schneiderei betrifft – ach! damit ging es schlimm. Denn erstens werden in Podolien die Juden, welche sich einem Handwerk widmen, fast sämtlich Schneider, und auch in Barnow gab es ihrer fünf Dutzend, und zweitens ging seit langen Jahren das unzuverlässige Gerücht durch die Gasse, Abraham Veilchenduft habe einmal die Jacke Nussans, des Fleischerknechts, schief geschnitten und Samuel, dem Dorfgeher, ein Beinkleid geliefert, das kaum zur halben Wade gereicht. Kurz, Abraham war nicht der Schneider der vornehmen Gesellschaft von Barnow und seine Firma wenig in Mode, was mit anderen Worten heißt, daß er allwöchentlich eine melancholische Hose oder einen lebensmüden Kaftan gegen eine Entlohnung von fünf Kreuzern zu flicken hatte. So war er denn notgedrungen auf jenes fünfte Gewerbe angewiesen, aber dieses ist ja bekanntlich ein überaus freies und die Konkurrenz gerade auch in Barnow erdrückend groß. Freilich konnte sich Abraham einer reichen Verwandten rühmen, seiner leiblichen Schwester Golde Hellstein, aber er mußte sich auch ausschließlich mit dem Ruhme begnügen. Denn diese Frau, welche sich durch ihre Geschicklichkeit zur Köchin des reichen Nachum Hellstein und, nachdem dieser Witwer geworden, durch das Gewicht ihrer Reize (sie wog an drei Zentner) zu seiner Ehegattin aufgeschwungen hatte, war sehr stolz und ließ sich nicht gerne an die arme Verwandtschaft im Sackgäßchen erinnern. Und so kam’s, daß Abraham und sein Weib und die sechs Kinder unendlich viel froren, hungerten und weinten. Eine schöne Sage erzählt, daß die Engel jede Träne aufzeichnen, welche jeder Mensch hienieden in seinem Schmerze weint. Wenn dies wahr ist, dann war der liebe Gott sicherlich genötigt gewesen, für die Familie Veilchenduft einen eigenen Engel anzustellen. Und der hatte dann wahrlich auch kein leichtes Leben.
Die geringste Arbeit machte ihm wohl noch der jüngste Sproß der Familie, der kleine Mosche. Nicht etwa, daß diesem ein günstigeres Los gefallen als seinen Eltern und Geschwistern, im Gegenteil! Denn eben weil er just das halbe Dutzend voll machte, war er schon bei seinem Eintritt in die Welt, woran er doch wahrlich unschuldig war, in wenig freundlicher Weise empfangen worden. Not macht hart. Die Eltern hatten sich bis dahin fünf Male unter immer schwereren Seufzern in das Wort der Schrift gefügt, daß Kinder ein Segen Gottes sind; beim sechsten Male jedoch waren sie entschieden überzeugt, daß auch allzuviel Segen ungesund ist. Die Geschwister aber erblickten darin vollends eine Tücke des Geschicks und in dem Ankömmling einen neuen Feind bei ihrem Kampfe um Brot und Suppe. Und als der Knabe heranwuchs, da setzten sich diese Gesinnungen nachdrücklich in Taten um: Not macht hart.
Ob auch die Püffe, die wir auf Erden erdulden, droben aufgezeichnet werden, erzählt die Sage nicht. Aber wenn dem so ist, dann hat Mosche allein in seinen Kindertagen mindestens drei Engel beschäftigt. Dem Tränenengel hingegen machte er, wie gesagt, geringe Arbeit: ob sie ihn auch noch so sehr pufften, er weinte nicht, keineswegs aus Trotz, sondern weil er eben nicht wehleidig war. Freilich lachte er auch nicht, wenn ihm eine spärliche Liebkosung wurde. Bei alledem gedieh er jedoch prächtig und wuchs stark und breit heran, als wäre er der Enaksöhne einer, vor denen sein Volk einst so sehr gezittert, und nicht das Kind des armen Schneiderleins und des verkümmerten Judenweibes, aufgesäugt unter Jammer und Tränen, emporgewachsen unter Not und Schlägen. Wenn es erlaubt ist, in diesen schlicht dem Leben nachgeschriebenen Zeilen ein triviales Wort anzuwenden, so könnte man sagen: Mosche war so recht ein Beweis dafür, daß man nie weiß, wovon der Mensch fett wird. Und das beste wär’s wohl, wenn uns dieser bescheidene Witz über die ganze, unsäglich harte Kinderzeit unseres Helden hinwegtragen dürfte. Denn die Menschen hören nicht gerne von traurigen Dingen, und das Allertraurigste auf dieser dunklen Erde ist ja eine Kinderzeit ohne jeden Sonnenschein. Aber es muß doch gesagt werden, wie der Knabe ward.
Er ward stark, weit über seine verkümmerte Rasse, weit über sein Alter hinaus. Er ward stark, und alles, was löblich und tadelnswert an ihm war, wurzelte in dieser Eigenschaft. Darum war er mutig – was konnte ihm auch geschehen? – und hieb gern um sich, nicht trotzig und frech, sondern mit einer Art stillen Behagens. Und mit demselben Behagen half er unermüdlich den Holzhauern und Fleischerknechten des Städtchens bei ihrer schweren Arbeit, weil solche Anstrengung den jungen Sehnen wohltat. Aber es war ihm peinlich, in der kleinen, dumpfigen Winkelschule über den krausen Zeichen zu grübeln, denn da half ihm seine Kraft nichts. Und weil die anderen Judenjungen waren, wozu sie ihr Körper und ihre Erziehung gemacht: fromm, faul, feig, so fiel des Schulklopfers Jüngster früh in der Gasse auf. Er hörte häufig: »Du bist wie ein Christenbub!« Darüber grübelte er nun in seiner Art. Denn er war nicht dumm, obwohl ihn alle dafür hielten, weil er unwitzig und schweigsam war und trotz aller Schläge das Hebräisch-Lesen nur notdürftig erlernt hatte. Ein Christenbub! dachte er anfangs, lächerlich, das sind ja meine Feinde! Und in der Tat wütete zwischen ihm und den Christenjungen des Orts ein ewiger Krieg; grimmiger haben Indianer und Weiße einander nie beschlichen. Weh dem Jungen, den er allein traf, weh Mosche, wenn ihn mehrere trafen! Der letztere Fall ereignete sich sehr oft, denn wenn er auch fast täglich an der Spitze eines lärmenden Haufens auszog, so blieb er doch allein, wenn es zum Treffen kam. Diese vorsichtige Gewohnheit seiner Kameraden verhalf ihm zu unzähligen Püffen, aber auch zu der Überzeugung: Ich bin doch anders, ich laufe nicht, ich bin wie ein Christenbub! Und als er älter wurde, da grübelte er auch schon ernster: Wie ein Christenbub bin ich und doch ein Jude, was soll aus mir werden? Er ward noch schweigsamer als bisher, und im Winter vor jenem Frühlingstage, an dem er sein dreizehntes Jahr vollenden sollte, hockte er tagelang brütend auf der Ofenbank seiner väterlichen Hütte, indes draußen der Kampfruf seiner Feinde erscholl und die Schneeballen herausfordernd an die kleinen Fenster klirrten. Endlich, an einem Freitagnachmittag, kam ihm die Erleuchtung. Er sprang auf und rief: »Ich hab’s, ich hab’s!«
»Was ist dir?« fragte die Mutter und schalt.
»Ich weiß, was ich werden will!« rief er und stürzte hinaus, den Feinden entgegen. Der Bann war von ihm gewichen, er schlug drein wie noch nie und bekam Schläge wie noch nie, bis endlich der eintretende Sabbat ihn zwang innezuhalten. Denn da darf man keinen Schneeball werfen und keinen Stock schwingen. Stolz kehrte er heim, lächelnd ließ er seine roten und blauen Flecken bewundern, und selig schlummerte er ein, von den schönsten Zukunftsträumen gewiegt.
Welchen Inhalts diese Träume waren, das sollte bald zum unsäglichen Entsetzen Abrahams und der gesamten Judenschaft von Barnow offenbar werden, eben an jenem Apriltage, da Mosche sein dreizehntes Lebensjahr vollendete.
Mit diesem Tage tritt der jüdische Knabe nach uralter, noch heute heiliggehaltener Vorschrift in den Kreis der Männer, mag er auch noch ein grünes, unreifes, drei Schuh hohes Bürschchen sein. Im Westen, wo Bildung und Gesittung wohnen, wo selbst ein uraltes Gesetz nur nach seiner Vernünftigkeit geschätzt wird, begnügt man sich damit, diese urplötzliche Wandlung des Kindes zum Manne durch einen rein religiösen Akt anzudeuten. Der Knabe legt die Gebetriemen an, er tritt als Gleichberechtigter in die Reihen der Beter. Anders im Osten, wo die Juden nicht bloß eine Religionsgenossenschaft sind, sondern auch noch eine Nation. Mit beispielloser Ängstlichkeit huldigen sie, ein schwächliches Handelsvolk im kalten Norden, noch immer der uralten Ordnung, welche einst den Bedürfnissen kräftiger Hirten, Winzer und Ackerbauern im heißen Jordantale angepaßt worden. Und so gilt denn heute noch in Podolien der dreizehnjährige Judenknabe in fast allen Beziehungen als reifer Mann. Er wählt, besonders wenn er armer Leute Kind ist, nun selbst seine Wege, er darf tun und lassen, was ihm beliebt, sofern er sich nur dabei sein Brot verdient. Wollte er ein Weib nehmen, die Satzung würde ihm nicht entgegenstehen, aber in der Regel tut er’s doch erst zwei, drei Jahre später. Kurz, die Anlegung der Gebetriemen ist für ihn ein Freibrief der Selbständigkeit, für seine Eltern aber der Freibrief, sich nicht länger für ihn zu mühen; das heißt natürlich nur, sofern sie dies nicht können oder wollen.
…..