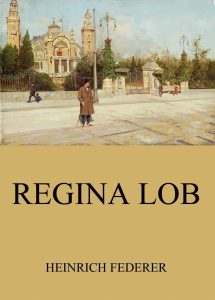Regina Lob – Heinrich Federer
Ein Roman entstanden aus den Aufzeichnungen eines Arztes. Federer gehört zu den bekanntesten Schweizer Schriftstellern und ist Ehrendoktor der Universität Zürich.
Format: eBook
Regina Lob.
ISBN eBook: 9783849655297
Auszug aus dem Text:
Dich deckt nun schon lange eine warme heimatliche Scholle, alter Freund, und doch hast du alle überlebt, von denen an späten Abenden am Küchenfeuer deine bärtige Lippe erzählt hat. In deinem großen Hause war das der gemütlichste Platz. Saure Trauben und süße Pflaumen wuchsen fast zu den Gesimsen herein, vom Garten schwatzte die Brunnenröhre durchs Dunkel herauf wie ein Klatschbäschen, das einfach nicht schlafen will, und dahinter hörte man das Geflüster einer großen Wiese. Aber wenn die taube Haushälterin im Gange herumschlürfte und etwa eine Stube offen ließ, schollen von der Vorderseite gegen die Straße und ihre Häuser späte Schuhe, Nachtbubenpfiffe, Pferdegetrappel und fernes Musizieren. Wir kauerten uns dann noch behaglicher in die verräucherte Ecke und leerten und füllten die Tasse Tee oder das Glas schwärzlichen Tessinerwein. Und ich legte die Hand auf dein Knie und bat: Fahre weiter von dir und deiner Regine!
Du saßest im Halbdunkel, und so seh’ ich dich heute noch, wo ich versuche, dein Erzähltes, soweit du mir erlaubt hast, wieder zu erzählen.
Und als so ein halbdunkler Mensch bist du selbst mir immer vorgekommen, und auch deine Bekenntnisse sind in ein solches Gemisch von Licht und Schatten getaucht, daß ich wohl ein Spaßen und Jubeln, aber dahinter auch eine See von schwerem Blut rauschen hörte. Ich versuche wohl umsonst, dieses Halbdunkel in Ton und Satz wiederzugeben. Aber das kann ich vielleicht, schlicht und warm sein, wie dein Wort es war.
Viele Jahre liegen die Blätter schon geschrieben. Immer zauderte ich mit dem Buche. Muß es nicht als zu jung, zu naiv, zu grün erscheinen, da ich es als schwärmerischer Jüngling auffing? Heute könnte ich jedenfalls nicht mehr so jung schreiben. Aber tönt das nicht eher wie Tadel als wie Lob?
Oder ist es am Ende eine zu alte Geschichte? Wie einer in sich und den allernächsten Menschen irrt und wiederfindet, o ja, das ist alt wie Adam. Aber schließlich bleiben wir doch, so neu wir uns auch geberden mögen, in eben jenem alten Adam stecken. Er ist doch immer auch der neueste Mensch.
Nein, ich gehe doch mit dem Buch zu einigen gläubigen Lesern hinaus. Lobt mich jemand, so steck ich es gerne ein. Gibt es Prügel, so nehme ich sie als Buße und werde nie mehr versuchen, aus anderem Munde etwas nachzusprechen und – ach, zu verderben.
Ich hatte eine kleine, aber schwere Reise angetreten, wovon mein sechsjähriges Kind und Mutterwaislein Mimeli mit seinen flinken Schwalbenaugen freilich nicht mehr sah, als was so ein junges Ding bei seinem ersten Fliegen sieht: maßlose Neuigkeiten zwischen Himmel und Erde. Nur seine Augen arbeiteten ohne Ruh. Das liebe Figürchen selbst mit seinem wachsweißen Gesicht stand unbeweglich wie ein Kerzenstock am Fenster. Aber diese Augen waren die heftigen Flämmchen daran und funkelten und glitzerten gewaltig in die große Landschaft hinaus. Zu fragen und andere Leute ungeduldig in seinen Genuß zu zwingen, wie die meisten Kinder pflegen, lag nicht in seiner Art, sondern von daheim her an vieles Alleinsein gewöhnt, fand sich Mimeli bei all seiner grünen Unwissenheit doch immer tapfer mit fremden Dingen ab und hatte rasch und ohne Vermittlung eine drollige Freundschaft mit ihnen geschlossen.
Mir, mit einer so großen Verwirrung im Kopf und einer solchen Zwiespältigkeit im Herzen, tat diese kleine aufrechte Selbständigkeit am Fenster jetzt ausnehmend wohl. Schau nur recht ins blitzende Hin und Her der Geleise, dachte ich, jetzt in die Halbwelt der Vorstadt, wo die breitesten Straßen plötzlich an einer Wiese aufhören, wie Menschen, die ein Herzschlag trifft – nun kommt ein Tunnel mit seinen Lichtern – zähl’ sie, das ist lustig! Nun das Land mit weiten, bleichen Feldern, den fern an den tiefen, grauen Horizont hinausgelagerten müden Dörfern. Und übersieh keinen der schläfrigen Bäche, die aus dem Ried hervorkriechen, und keine der Krähen, die auf den Telegraphenstangen wie alte Philosophen sitzen und wie alle richtigen Denker vor dem Gelärm der Menschen Reißaus nehmen! Ja, Kind, nimm das alles still und tüchtig auf und lege es dir zurecht! Und frag’ mich nichts; ich habe genug mit mir selber zu tun!
Ich tupfte nervös den Takt irgendeiner zerfahrenen Musik auf die Lehne. Sowie ich nur leise meine Gedanken um das Vorhaben und Ziel der Reise ordnen wollte, schlug mein Puls heftiger und benebelte mich eine heillose, düstere Bangigkeit. Ich sah dann plötzlich ein Gefunkel von vielen kleinen Fensterscheiben an einem vornehmen Haus über dem stolzen Bergdorf Ilgis. Ich fühlte voraus, wie ich mich da hineinschliche, an der Stube klopfte und wie eine tiefe Altstimme »Herein« riefe. Sogleich stände ich vor einer hohen, dunkelprächtigen Frau. Sie würde überrascht und gehässig einige Schritte zurückweichen und, wie ich ihr in die Stube folge, sähe mich nun auch ein riesengroßer, aber totenbleicher Mann auf dem Sofa, Gott, mit was für Augen an . . . Von jetzt in vier Stunden wird das so geschehen!
Weg, weg! Das kommt alles früh genug!
Es saßen wenige Leute im kleinen, bequemen Nichtraucherwagen. Waren es mehr Frauen oder Herren? Was trugen sie für Gesichter? Schweizerische oder fremde? Und was las man für Geschichten davon ab? wilde oder zahme? Ach, dieses sonst so unerschöpfliche Eisenbahnkapitel, das mir sonst die längste und einsamste Strecke so prächtig kürzt, versuchte ich umsonst anzuspinnen! In alles Sinnen mischte sich sogleich das Antlitz jener Frau, die ich vor vielen Jahren so schwer beleidigt hatte und zu der ich nun wie ein redlicher, aber furchtsamer Büßer pilgerte, um Versöhnung zu holen.
Die Fahrt ist so still, das Gespräch im Wagen so leise und das Geräusch der auf und niedergehenden Kurbeln so tödlich gleichmäßig, daß man entweder einschlafen oder von der Vergangenheit träumen muß, was ja halbwegs auch ein Schlafen ist. Und da kommt sie schon wieder, die laute, scharfe Schönheit jenes Weibes, meiner Feindin von Anbeginn . . .
Ihr Gemahl, Theodor Weggisser, war mein dauerhafter, unzertrennlicher Freund durch alle Jugend gewesen. Neun Jahre hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Im letzten Weinmonat, zu einer Zeit, wo man in seinem hochgelegenen Alpendorf nie recht weiß, ob man den Ofen einheizen soll oder nicht, hatte er sich in seiner bald heißen, bald eiskalten Schreibstube erkältet, und der Riese, der dem Doktor noch nie einen Batzen zu verdienen gegeben hatte, fiel in eine so strenge Brustfellentzündung, daß seit vier Monaten kein Mensch so oft über die Schwelle ging wie Doktor Bersolt, der alte Ilgisser Arzt. Theodor erholte sich zweimal und erlitt zweimal einen Rückfall. Nun ging der Mann in einem langsamen Verbröckeln seiner prachtvollen Manneskraft durch die kurzen, schneehellen Tage des Hornung dem Tode entgegen. Und während man an seinem Sofa spaßte und alle Schelmereien des Dorfes erzählte, flüsterte man draußen vor der Stube, wie man wohl – in drei Wochen oder in drei Tagen? – mit dem Sarge die engen Stiegen hinuntergelange. Von der bösen Krankheit wußte ich lange schon. Aber daß es so hurtig zum Sterben gehe, erst seit gestern. Der Ilgisser Fabrikant Eisen war mit seinem jungen, schlanken Bengel in die Stadt gekommen. Ich sollte dem guten alten Bekannten eine Privatschule ausfindig machen, wo man seinem Schlingel – der Vater war aufs Haar so ein Flegel gewesen – den Übermut austreiben würde. Und wenn es ein bißchen ginge, sollte ich dem Jungen bei mir Quartier geben . . . Nebenbei gesagt: Theodor sei am Verscheiden . . .
Dieses Nebenbei erschütterte mich. Denn Theodor Weggisser war nicht etwa nur irgendein Bankgenosse durch die lange Marter der Schule, sondern, was tiefer ins Blut geht, der vertrauteste Gespan im heißen, herrlichen zweiten Jahrdutzend meines Lebens gewesen. Welch eine Zeit war das von amo-amas-amat bis zum letzten Examen im Wichs meines schwarzen, langen Schnurrbarts und meines noch längern und schwärzern Staatsfracks!
…..