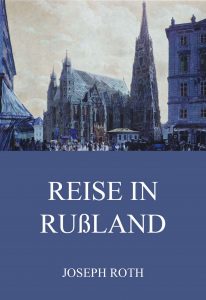Reise in Rußland – Joseph Roth
Als Roth bereits nach einem Jahr von Friedrich Sieburg als Korrespondent der Frankfurter Zeitung in Paris abgelöst wurde war er schwer enttäuscht. Zum Ausgleich verlangte er von der FZ mit großen Reisereportage-Serien beauftragt zu werden. Vom September bis Dezember 1926 bereiste er die Sowjetunion und berichtet in diesem Band von seinen Erlebnissen.
Format: eBook
Reise in Rußland.
ISBN eBook: 9783849656928.
Auszug aus dem Text:
I. Die zaristischen Emigranten
Frankfurter Zeitung, 14. 9. 1926
Lange bevor man noch daran denken konnte, das neue Rußland aufzusuchen, kam das alte zu uns. Die Emigranten trugen den wilden Duft ihrer Heimat, der Verlassenheit, des Bluts, der Armut, des außergewöhnlichen, romanhaften Schicksals. Es paßte zu den europäischen Klischee-Vorstellungen von den Russen, daß sie solches erlebt hatten, Ausgestoßene waren, von warmen Herden Vertriebene, Wanderer durch die Welt ohne Ziel, Entgleisende mit der alten literarischen Verteidigungs-Formel für jeden Sprung über gesetzliche Grenzen: “die russische Seele”. Europa kannte die Kosaken aus dem Varieté, die russischen Bauernhochzeiten aus opernhaften Bühnenszenen, die russischen Sänger und die Balalaikas. Es erfuhr (auch nachdem Rußland zu uns gekommen war) niemals, wie sehr französische Romanciers die konservativsten der Welt – und sentimentale Dostojewski-Leser den russischen Menschen umgelogen hatten zu einer kitschigen Gestalt aus Göttlichkeit und Bestialität, Alkohol und Philosophie. Samowarstimmung und Asiatismus. Was hatten sie aus der russischen Frau gemacht! – Eine Art Menschtier, mit Treue begabt und Leidenschaft zum Betrug, eine Verschwenderin und eine Rebellierende, eine Literatenfrau und eine Bombenfabrikantin. Je länger die Emigration dauerte, desto näher kamen die Russen der Vorstellung, die man sich von ihnen gemacht hatte. Sie taten uns den Gefallen und assimilierten sich an unser Klischee. Das Gefühl, Träger einer “Rolle” zu sein, linderte vielleicht ihr Elend. Sie trugen es leichter, wenn sie literarisch gewertet wurden. Der russische Fürst als Chauffeur eines Pariser Taxis steuert unmittelbar in die Literatur. Sein Schicksal mag grausam sein. Aber es ist belletristisch verwendbar.
Das anonyme Leben der Emigranten wurde eine öffentliche Produktion. Wie erst, wenn sie sich selbst zur Schau stellten. Hunderte gründeten Theater, Sängerchöre, Tanzgruppen und Balalaika-Orchester. Zwei Jahre lang waren alle neu, echt, verblüffend. Später wurden alle selbstverständlich und langweilig. Sie verloren die Beziehung zur heimatlichen Erde. Sie entfernten sich immer mehr von Rußland – und Rußland noch mehr von ihnen. Europa kannte schon Meyerhold – sie hielten immer noch bei Stanislawsky. Die “blauen Vögel” fingen an, deutsch, französisch, englisch zu singen. Schließlich flogen sie nach Amerika und verloren das Gefieder.
Die Emigranten betrachteten sich als die einzigen Vertreter des Echt-Russischen. Was nach der Revolution in Rußland wuchs und von Bedeutung wurde, verleumdeten sie als “unrussisch”, “jüdisch”, “international”. Europa hatte sich längst daran gewöhnt, in Lenin einen russischen Repräsentanten zu sehen. Die Emigranten hielten noch bei Nikolaus dem Zweiten. Sie hielten mit rührender Treue an der Vergangenheit fest, aber sie vergingen sich gegen die Geschichte. Und sie selbst reduzierten ihre Tragik.
Ach! sie mußten leben. Deshalb ritten sie in Pariser Hippodromen heimatliche Kosaken-Galoppe auf fremdblütigen Pferden, bekleideten sie sich mit krummen Türkensäbeln, die auf dem Flohmarkt von Glignaucourt erworben waren, führten sie leere Patronentaschen und stumpfe Dolche auf dem Montmartre spazieren, setzten sie auf ihre Häupter große Bärenmützen aus echten Katzenfellen und standen furchtbar anzusehn als Häuptlinge aus Dongebieten vor den Drehtüren der Etablissements, auch wenn sie in Wolhynien zur Welt gekommen waren. Manche avancierten auf unkontrollierbaren Nansen-Pässen zu Großfürsten. Es war ja auch gleichgültig. Alle konnten sie mit der gleichen Fertigkeit aus den Balalaikas Heimweh und Schwermut zupfen, rote Saffianstiefel mit silbernen Sporen tragen und hockend in tiefer Kniebeuge auf einem Absatz herumwirbeln. Eine Fürstin sah ich in einem Pariser Varieté eine russische Hochzeit darstellen. Sie war eine strahlende Braut, Nachtwächter aus der Rue Pigalle, als Bojaren verkleidet, wuchsen Spalier, wie aus Blumentöpfen, eine Kathedrale aus Pappe leuchtete im Hintergrund, aus ihr trat der Pope mit einem Bart aus Watte, gläserne Edelsteine funkelten im russischen Sonnenglanz, der aus dem Scheinwerfer floß und die Kapelle träufelte aus gedämpften Geigen das Lied von der Wolga in die Herzen des Publikums. Andere Fürstinnen waren Kellnerinnen in russischen Lokalen, Notizblöcke hingen an tulasilbernen Ketten an ihren Schürzen, ihre Köpfe standen stolz im Nacken, Musterbeispiele standhafter Emigrantentragik.
Andere, Gebrochene, saßen still auf den Bänken der Tuilerien, des Luxemburggartens, des Wiener Praters, des Berliner Tiergartens, an den Ufern der Donau in Budapest und in den Caféhäusern von Konstantinopel. Mit den Reaktionären eines jeden Landes hatten sie Verbindung. Sie saßen da und trauerten ihren gefallenen Söhnen und Töchtern nach, ihren vermißten Frauen – aber auch der goldenen Taschenuhr, dem Geschenk Alexanders des Dritten. Viele hatten Rußland verlassen, weil sie “das Elend des Landes nicht ansehen konnten”. Ich kenne russische Juden, die, noch vor wenigen Jahren von Denikin und Petljura “enteignet”, heute dennoch nichts mehr auf der Welt hassen als Trotzki, der ihnen nichts getan hat. Sie wollen ihren falschen Taufschein wieder haben, mit dem sie sich demütig, unwürdig einen verbotenen Aufenthalt in den großen russischen Städten erschlichen hatten.
In dem kleinen Hotel im Pariser Quartier Latin, in dem ich wohnte, lebte einer der bekannten russischen Fürsten, mit Vater, Frau, Kindern und einer “bonne”. Der alte Fürst war noch echt. Er kochte seine Suppe auf einem Spirituskocher, und, obwohl er mir bekannt war als eine antisemitische Kapazität und eine Leuchte im Bauern-Schinden, erschien er mir dennoch rührend an feuchten herbstlichen Abenden, durch die er frierend kroch, ein Symbol, kein Mensch mehr, ein Blatt, abgeweht vom Baum des Lebens. Aber sein Sohn, in der Fremde erzogen, elegant von Pariser Schneidern eingekleidet, von reicheren Großfürsten erhalten – wie anders war er! Im Telephonzimmer konferierte er mit gewesenen Leibgardisten, an falsche und an echte Romanows schickte er Ergebenheits-Adressen zu Geburtstagen und den Damen im Hotel legte er kitschige rosa Liebesbriefchen in die Schlüsselfächer. Zu zaristischen Kongressen eilte er in Automobilen und er lebte wie ein kleiner emigrierter Gott in Frankreich. Wahrsager, Popen, Kartenleser, Theosophen kamen zu ihm, alle, die die russische Zukunft kannten, die Wiederkehr der großen Katharina und der Trojkas, der Bärenjagden und der Kalorga, Rasputins und der Leibeigenschaft…
Alle verloren sich. Sie verloren das Russentum und den Adel. Und, weil sie nichts mehr gewesen waren als Adelige und Russen, hatten sie alles verloren. Sie sanken aus ihrer eigenen Tragik. Dem großen Trauerspiel entfielen die Helden. Die Geschichte ging unerbittlich ihren eisernen und blutigen Weg. Unsere Augen wurden müde, ein Elend zu betrachten, das sich selbst so billig gemacht hatte. Wir standen vor den Überresten, die ihre eigene Katastrophe nicht begriffen, wir wußten mehr von ihnen, als sie uns erzählen konnten, und, Arm in Arm mit der Zeit, gingen wir über die Verlorenen hinweg, grausam und dennoch traurig. –
II. Die Grenze Niegoreloje
Frankfurter Zeitung, 21 9. 1926
Die Grenze Niegoreloje ist ein großer brauner hölzerner Saal, in den wir alle eintreten müssen. Gütige Träger haben unsere Koffer aus dem Zug geholt. Die Nacht ist sehr schwarz, es ist kalt und es regnet. Deshalb sahen die Träger so gütig aus. Mit ihren weißen Schürzen und ihren starken Armen kamen sie uns helfen, als wir fremd an die Grenze stießen. Ein Mann, der dazu befugt war, hat mir noch im Zug den Paß abgenommen, mich meiner Identität beraubt. So, ganz und gar nicht ich, ging ich über die Grenze. Man hätte mich mit jedem beliebigen Reisenden verwechseln können. Später allerdings stellte es sich heraus, daß die russischen Zollrevisoren mich nicht verwechselten. Intelligenter als ihre Kollegen aus andern Ländern wußten sie, zu welchen Zwecken ich reise. Im braunen hölzernen Saal hatte man uns schon erwartet. Gelbe, warme elektrische Lampen waren an der Decke entzündet. Auf dem Tisch, an dem der Oberste der Zollrevisoren saß, brannte, freundliche Grüßerin aus vergangenen Zeiten, eine Petroleumlampe mit Rundbrenner und lächelte. Die Uhr an der Wand zeigte die osteuropäische Zeit. Die Reisenden, beflissen, ihr nachzukommen, rückten ihre Uhren um eine Stunde vor. Es war also nicht mehr zehn, sondern schon elf. Um zwölf mußten wir weiterfahren.
Wir waren wenige Menschen, aber viele Koffer. Die meisten gehörten einem Diplomaten. Sie blieben laut Gesetz unberührt. Keusch, wie sie vor der Abfahrt gepackt waren, müssen sie am Ziel ankommen. Sie enthalten nämlich sogenannte Staatsgeheimnisse. Dagegen werden sie sorgfältig in Listen eingetragen. Es dauerte lange. Der Diplomat beschäftigte unsere tüchtigsten Revisoren. Und indessen verstrich die osteuropäische Zeit.
Draußen, in der feuchten Schwärze der Nacht, rangierte man den russischen Zug. Die russische Lokomotive pfeift nicht, sondern heult wie eine Schiffssirene, breit, heiter und ozeanisch. Wenn man durch die Fenster die nasse Nacht sieht und die Lokomotive hört, ist es wie am Ufer des Meeres. In der Halle wird es beinahe behaglich. Die Koffer fangen an sich auszubreiten, aufzugehen, als wäre ihnen heiß. Aus dem dicken Gepäck eines Kaufmanns aus Teheran klettern hölzerne Spielzeuge, Schlangen, Hühner und Schaukelpferde. Kleine Stehaufmännchen schaukeln leise auf dem bleibeschwerten Bauch. Ihre bunten, lächerlichen Gesichter, von der Petroleumlampe grell beleuchtet, von vorüberhuschenden Schatten der Hände abwechselnd verdunkelt, werden lebendig, verändern ihren Ausdruck, grinsen, lachen und weinen. Die Spielzeuge klettern auf eine Küchenwaage, lassen sich wiegen, kollern wieder auf den Tisch und hüllen sich in raschelndes Seidenpapier. Aus dem Koffer einer jungen, hübschen und etwas verzweifelten Frau quillt schimmernde, schmale, bunte Seide, Streifen eines zerschnittenen Regenbogens. Dann folgt Wolle, die sich bauscht, bewußt atmet sie wieder frei nach langen Tagen luftloser, zusammengepreßter Existenz. Schmale graue Halbschuhe mit Silberspangen legen ihr Zeitungspapier ab, das sie verbergen sollte, die vierte Seite des “Matin”. Handschuhe mit bestickten Manschetten entsteigen einem kleinen Sarg aus Pappendeckel. Wäsche, Taschentücher, Abendkleider, groß genug um eine Hand des Revisors zu bekleiden, schweben empor. Alle spielerischen Utensilien einer reichen Welt, alle eleganten, polierten Sächelchen liegen fremd und dreifach nutzlos in dieser harten, braunen, nächtlichen Halle, unter den schweren Balken aus Eichenholz, unter den strengen Plakaten mit den eckigen Buchstaben wie geschliffene Beile, in diesem Duft von Harz, Leder und Petroleum. Da stehen die flachen und die bauchigen kristallenen Flakons mit den saphirgrünen und bernsteingelben Flüssigkeiten, lederne Maniküretuis öffnen ihre Flügel wie heilige Schreine, kleine Damenschuhe trippeln über den Tisch.
….