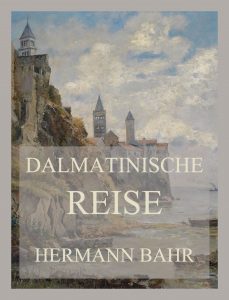Dalmatinische Reise – Hermann Bahr
Dieses kleine Bändchen, das zweifellos auf Hermann Bahrs fast schon klassischer Balkanreise beruht, ist erklärtermaßen eine bloße Aufzeichnung flüchtiger Eindrücke: nach den Worten seines Autors ist es “im Grunde kein Baedeker, sondern ein Bekenntnis”. Aber es ist hervorragend lesbar, sein Stil hat eine Lebendigkeit, die man in der deutschen Sprache nicht allzu oft findet; und nebenbei bietet es viele neue Informationen über so unterschiedliche Dinge wie die berühmten Prophezeiungen von Mateja, die Räuber des Sandjak, die jungen muslimischen Schriftsteller von Bosnien und ihre Kampagne gegen den Schleier. Es folgen eindrucksvolle Beschreibungen von Uzice, das einst das serbische Mekka genannt wurde; von Sarajevo, das er “der Untergang des Orients” nennt; vom wunderschönen Dubrovnik (Ragusa) mit seiner langen republikanischen Tradition; oder auch von Lovcen, “der Bastion der serbischen Freiheit”; vom armen Land des Schwarzen Berges.
Format: eBook/Taschenbuch.
DDalmatinische Reise.
ISBN eBook: 9783849662028
ISBN Taschenbuch: 9783849665999
Auszug aus dem Text:
1.
Jetzt kommt es wieder! Immer um diese Zeit. Wenn der Februar sich in den kahlen Ästen dehnt.
Oft um Weihnachten schon geschieht es mir, dass ich, auf dem Semmering vom Doppelreiter zum Wolfsbergkogel rodelnd, plötzlich das Meer sehe, das blaue Meer. Nur einen Moment lang. Der Wind schneit mich an, die Nadeln zergehen, mich wässert in den Augen; und indem ich sie schließen muss, begibt es sich, dass ich das blaue Meer sehe. Die Lider, fest vor dem stechenden Schnee zugepresst, lassen mich das blaue Meer sehen. Nur einen Moment lang. Schon bin ich wieder wach und erblicke den Eselstein, drüben vor mir, im wogenden Grau. Das blaue Meer haben mir bloß meine Lider vorgeträumt. Nur einen Moment lang. Aber diesen war es in mir da. Und mitten im nebligen Dampf und stachligen Schnee weiß ich jetzt plötzlich wieder, dass irgendwo das blaue Meer ist. Und während ich dann, von der Station den weich verschneiten Berg hinauf, schnaufend meine Rodel schleppe, sagt alles in mir: Blau, blau, blau! Das ist mir wie ein magisches Wort, das alle Sehnsucht stillen kann. Und abends dann, im winterlichen Behagen frottierter Füße in frischen Strümpfen, wenn im Kamin die großen Scheite krachen und ihre roten Zungen zeigen, verfolgt es mich. Immer mit denselben beiden Bildern: ich sehe mich in Mattuglie aus dem Zug steigen und vor mir liegt in der Sonne das blaue Meer da, bis zur Insel Cherso hin; oder ich bin über San Giacomo, auf der weißen Straße nach Trebinje, und unten ist das blaue Meer und drüben das immergrüne Lakroma und dann wieder das blaue Meer und überall das blaue Meer, jauchzend in der Sonne. Immer diese zwei Bilder sind dann bei mir, zum Greifen leibhaft vor mir da. Bis ein großes Scheit prasselnd einbricht und mich aufschreckt: das Gesicht zerrinnt, zum Fenster sehen die stillen alten Fichten herein, in ihren weißen Mänteln.
Und in der hellen Winterslust wird es wieder vergessen. Wochenlang. Aber wenn dann im Februar plötzlich manchmal nachts ein warmer Wind über den Acker fliegt, dass man aus dem Schlaf ans Fenster fährt, als hätte drunten im Garten das Glück gerufen, das Glück selbst mit seiner wilden Stimme, wie mit Peitschenknall, wenn das bange Stöhnen in den nackten Ästen ist, wenn die Wolken, wie tolles Vieh, in Angst und Entsetzen durcheinander rennen, dann kann ich nicht mehr, dann weiß ich sonst gar nichts mehr, dann bin ich überall bis an den Rand von Gier voll, Gier nach dem Meer, nach unserem blauen Meer in der Sonne.
Immer um diese Zeit. Wenn man am Zittern der kahlen Äste merkt, dass schon das Blut in ihnen schlägt.
Und dann steht wieder jene Zeit in mir auf, jene dunkle Zeit vor fünf Jahren. Da war ich am Tode, die Kraft entsank meinem Herzen. Der Arzt schickte mich nach einer Anstalt am Bodensee. Ganz einsam saß ich dort, in Erwartung. Schnee. Sturm. Nebel. Und kein Atem. Und die Furcht. Damals habe ich das Wort Trübsinnig verstehen lernen. Und Schleimsuppe. Und kein Mensch. Vita minima, innen und außen. Und kein Schlaf. Da saß ich und sah dem Nebel zu. Mein Kopf sah zu, mein Kopf lebte noch; sonst war ich abgestorben. Einmal las ich damals, Konrad Ferdinand Meyer habe von seiner Mutter gesagt, sie sei »heiteren Geistes, traurigen Herzens« gewesen. Dies traf mich so, dass es mir geblieben ist. Es war wie von mir gesagt. Traurig hatte ich das Herz, den heiteren Geist focht es nicht an. Ich las den ganzen Tag. Um abends kein Wort davon zu wissen. Ich konnte zuletzt nicht mehr durch das Zimmer gehen. Da sagte der Geist zu mir: Das blaue Meer! Und der Geist gebot mir zu fliehen. Ich gehorchte. Ich fürchtete den Tod gar nicht mehr. Nur voll Angst war ich, das blaue Meer nicht mehr zu sehen. Das blaue Meer noch einmal zu sehen war alles, was ich wusste. Das hatte ich noch zu tun. Dann war’s gut. Dann meinetwegen –.
So floh ich. Ich erinnere mich noch an den merkwürdigen Abend im Inselhotel in Konstanz. An diesem Tag war der Frühling angekommen. Der See glänzte, weiß flog sein Schaum auf. Das Inselhotel ist ein altes Kloster, Dominikaner haben hier gehaust. Ich war der einzige Gast. Da saß ich, ließ mir Rheinwein bringen und rauchte große Zigarren. Ich fand, dass alles, was es auf der Erde gibt, wunderschön ist; und, als hätte ich das noch gar nicht gewusst, sondern eben jetzt erst entdeckt. Und ich dachte mir, dass kein Mensch sterben kann, so lange er noch mit seinen Augen sieht, wie schön die Welt ist; er darf nur die Augen nicht sinken lassen. Da hörte mein Herz auf, so traurig zu sein. Am anderen Morgen musste ich früh heraus. Noch war die Nacht übrig, als ich zum Schiff ging. In Geheimnissen standen die Bäume des Stadtgartens, die Umrisse der alten Häuser. Nun hatte ich im Hafen zu warten. Der Horizont war wie ein großer schwarzer Ring. Gaslicht, elektrisches daneben, grünes und rotes an schwanken Schiffen und an der Bahn, durch weißen Nebel glühend. Die Uhr der Station und noch eine andere Uhr am Ufer wie zwei große böse Monde. Und der stille Morgenstern. Und plötzlich ein Blitz, erst violett, dann rot, die Sonne kommt, die Nebel fallen, es lacht der Tag. Da fuhr ich über den hellen See.
Nach vierundzwanzig Stunden war ich in Mattuglie. Da lag das blaue Meer vor mir, bis zur Insel Cherso hin. Zwei Wochen später bin ich nach Athen gefahren. Auf der Akropolis saß ich, vor dem kleinen Tempel der Nike, Schwärme von Veilchen schienen im Meer zu schwimmen. Da fragte ich mein Herz. Froh war es.
Und immer, seitdem, wenn es im Norden und Nebel verzagen will, zupft es mich und verlangt hinab, an das blaue Meer, zur Sonne. Immer um diese Zeit, wenn aus nackten braunen Schollen das Erwachen dampft.
Damals, vor fünf Jahren, ist mein ganzes Leben anders worden. Denn ich weiß jetzt, dass der Mensch durch den Geist und vom Willen aus eine viel größere Macht über Leiden hat, als wir glauben. Meine Wiederkehr zum Leben ist damals durch das Gemüt geschehen. Ich habe mich entschlossen, nicht zu sterben: anders kann ich es nicht sagen. Die Ärzte nannten es ein Wunder. Ich habe seitdem ein fast unverschämtes Vertrauen zur inneren Heilkraft. Es kommt in der Not nur darauf an, sie zu finden. Sie scheint sich dann zu verkriechen; fast hat man das Gefühl, als wäre sie faul; sie will nicht, sie hat Scheu, sich herzugeben. Und ich finde sie nur am Meer. Vielleicht ist das ein Aberglaube. Immer aber, wenn ich unfähig bin, meinen Willen zum Leben zu wecken, treibt es mich seitdem ans Meer. Da springt er auf und ist bereit.
Ein rechter Heliotrop bin ich. Zur Sonne muss ich mich wenden. So viel Sonne scheint, so viel Kraft wird mir. Das zieht mich jedes Jahr nun wieder ins Sonnenland, nach Dalmatien. Wie eine Wallfahrt ist es, um von Angst und Trübsal in Licht und Wärme zu genesen.
Nun ist aber Dalmatien nicht bloß ein Sonnenland, Märchenland, Zauberland, sondern nebenbei auch noch eine Provinz der österreichisch-ungarischen Monarchie. Es kommen fast keine Fremden hin, und die paar Fremden, die kommen, verstehen die Sprache nicht und verkehren mit den Leuten nicht. In anderen Provinzen glaubt Österreich zuweilen den Fremden ein bisschen Europa vorspielen zu müssen. Hier hat es das nicht nötig. Hier kann es sich noch unverdorben zeigen. Hier steht es nackt da, wie im Paradiese.
Und darum ist mir diese Fahrt, jedes Jahr, wenn ich dem Winter entfliehe, immer auch eine Wallfahrt zum alten Österreich. Die Bora bläst mir meine Kraft wieder auf und ich lerne wieder ein bisschen Österreichisch. Es kann beides nicht schaden.
…..