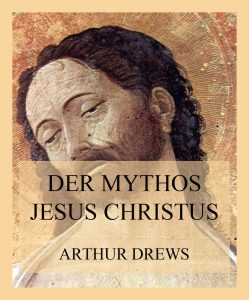Der Mythos Jesus Christus – Arthur Drews
Die Frage, ob Jesus jemals gelebt hat, zieht immer wieder die Aufmerksamkeit von Philosophen und Theologen auf sich. Drews’ Buch leugnet die Historizität Jesu und seine Schlussfolgerungen wurden bereits bei der Erstveröffentlichung des Buches Anfang des 20. Jahrhunderts ausführlich untersucht. Während die in dem Buch dargelegten Ansichten vielleicht nicht einem breiten Leserkreis gefallen, ist der Autor dennoch einer der führenden Verfechter einer skeptischen Bewegung. Er bietet dem Leser nicht nur eine klare Darstellung der stärksten Argumente, die gegen die Glaubwürdigkeit der christlichen Überlieferungen über Jesus angeführt werden können, sondern auch eine konstruktive Erklärung des wahren Ursprungs des Christentums, wie es von vielen Kritikern interpretiert wird. Seine grundlegende Behauptung ist, dass das Urchristentum seine anfängliche Inspiration nicht von Jesus als einzigartiger menschlicher Persönlichkeit bezog, wie die moderne kritische Theologie behauptet, sondern von der Anbetung eines Jesus als Erlöser – Gott, der von den frühen Auslegern der neuen Religion allmählich eine konkrete, aber fiktive menschliche Gestalt erhielt.
Format: eBook/Print
Der Mythos Jesus Christus.
ISBN eBook: 9783849661014
ISBN Print: 9783849667405
Auszug aus dem Text:
DER VORCHRISTLICHE JESUS
“Wenn du einen Menschen siehst, unerschrocken in Gefahren, unberührt von Leidenschaften, unter widrigem Geschicke glücklich, mitten im Sturme ruhig: wird dich nicht Verehrung ankommen? Wirst du nicht sagen: das ist etwas Größeres und Höheres, als dass man es für gleichartig halten könnte dem armen Leib, in dem es wohnt? Eine göttliche Kraft ist hier herabgekommen, eine himmlische Kraft ist es, von der die treffliche, besonnene, über alles Niedrige sich erhebende, all unser Fürchten und Wünschen verlachende Seele bewegt wird. So Großes kann nicht ohne Hilfe der Gottheit bestehen; also ist es seinem größeren Teile nach dort heimisch, von wo es herabgekommen ist. Wie die Sonnenstrahlen die Erde zwar berühren, aber da zu Hause sind, von wo sie ausgehen, so ist’s mit dem großen und heiligen Geist, der hierher herabgesandt ist, damit wir das Göttliche näher kennen lernen: er verkehrt zwar mit uns, aber er haftet an seinem Ursprung. Von dort hängt er ab, dorthin schaut und strebt er; bei den Menschen weilt er nur, wie ein besserer Gast. Welches ist nun dieser? Es ist der Geist, der sich auf kein Gut verlässt, als auf sein eigenes. Das Eigene des Menschen ist die Seele und die vollkommene Vernunft (Logos) in ihr; denn ein Vernunftwesen ist der Mensch; darum vollendet sich sein Gut, wenn er seine vernünftige Bestimmung erfüllt hat.”
Mit diesen Worten schildert der römische Philosoph Seneca (4 v. Chr. bis 65 n. Chr.) das Idealbild des großen und guten Menschen, um zu seiner Nacheiferung aufzufordern. 1 “Irgendeinen guten Menschen”, sagt er, “müssen wir uns aussuchen und immer vor Augen haben, damit wir so leben und handeln, als ob er uns zuschaue. Ein großer Teil der Sünden unterbleibt, wenn vor der Tat ein Zeuge zugegen ist. Einen muss unser Herz haben, den es verehrt, von dessen Vorbild es auch sein geheimes Leben weihen lässt. Glücklich, wer so einen verehren kann, dass er sich selbst nach seinem in der Erinnerung lebenden Bilde gestaltet! Wir bedürfen einen, nach dem unsere Sitten sich richten. Ohne Richtschnur wird Verkehrtes nicht zurechtgebracht.” 2 “Ziehe an den Geist eines großen Mannes und trenne dich von den Meinungen der Menge! Erfasse das Bild der schönsten und erhabensten Tugend, die nicht durch Kränze, sondern durch Schweiß und Blut zu verehren ist!” 3 “Dürften wir in die Seele eines guten Menschen einen Blick werfen, o, welch schönes Bild würden wir da schauen, wie ehrwürdig, strahlend von Hoheit und Ruhe! Da würden leuchten Gerechtigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit und Weisheit, und über alle würde die Menschlichkeit, das seltene Gut, ihren Glanz ausgießen, jeder würde ihn liebenswürdig, jeder zugleich verehrungswürdig nennen. Wenn jemand dies Bild schauen würde, erhabener und glänzender, als es unter Menschen sich zu zeigen pflegt: würde er da nicht, wie vor einer Gottheit, staunend stille stehen und stille beten, dass dies Schauen ihm vergönnt sei? Dann, durch die einladende Güte jenes Gesichtes selbst hingezogen, würde er anbetend niedersinken und nach langer Betrachtung voll staunender Ehrfurcht in die Worte Virgils ausbrechen: ,Heil dir, wer du auch seist, o lindere unsere Mühsal!’ Keiner ist, ich wiederhole es, der nicht von Liebe entbrennen würde, wenn uns ein solches Idealbild zu schauen vergönnt wäre. Jetzt freilich sind unsere Augen durch vieles geblendet; aber wenn wir sie reinigen und unsere Sehkraft befreien wollten, dann vermöchten wir die Tugend zu schauen auch unter der Hülle des Körpers, auch unter dem Druck der Armut, Niedrigkeit und Schande; sehen würden wir ihre Schönheit auch unter der schmutzigsten Hülle.” 4
Die Stimmung, die in diesen Worten zum Ausdruck gelangt, war in der gesamten antiken Kulturwelt um die Wende unserer Zeitrechnung weitverbreitet. Ein quälendes Gefühl der Unsicherheit alles Irdischen drückte wie ein Alb auf vielen Gemütern. Die allgemeine Not der Zeit, der Zusammenbruch der Nationalstaaten unter der harten Faust des römischen Eroberers, der Verlust der bisherigen Selbständigkeit, die Zerfahrenheit der politischen und sozialen Zustände, die unaufhörlichen Kriege und das hierdurch bedingte große Sterben: dies alles drängte die Menschen auf ihr eigenes Inneres zurück und nötigte sie dazu, für die Einbuße an äußerem Glück sich nach einer Stütze in einer die Seele erhebenden und ermutigenden Weltanschauung umzusehen. Aber die antike Weltanschauung hatte sich ausgelebt. Jene naive Ineinssetzung von Natur und Geist, jene unbefangene Hingabe an die Wirklichkeit der Dinge, wie sie der Ausdruck der jugendlichen Lebenskraft der Mittelmeervölker gewesen war, und aus welcher heraus die Wunderwerke der antiken Kultur geschaffen waren, war erschüttert. Geist und Natur standen sich in der Anschauung der Menschen jener Zeit als zwei feindliche und unvereinbare Gegensätze gegenüber. Alle Bemühungen, die zerstörte Einheit wiederherzustellen, scheiterten an der Unmöglichkeit, für das verlorene Paradies die ursprüngliche Stimmung zurückzugewinnen. Ein unfruchtbarer Skeptizismus, der niemanden befriedigte, und aus dem man doch keinen Ausweg wusste, lähmte alle Freudigkeit der inneren und äußeren Betätigungsweise und ließ die Menschen nicht zu einem wirklichen Genüsse ihres Daseins kommen. Da richteten sich die Blicke sehnsuchtsvoll nach einem übernatürlichen Halt, nach unmittelbarer göttlicher Erleuchtung, nach “Offenbarung”, und der Wunsch entstand, durch Anlehnung an ein fremdes vorbildliches und übermenschliches Wesen die verlorene Sicherheit der Lebensführung wiederzufinden.
Viele sahen in der erhabenen Person des Kaisers ein solches göttliches Wesen verkörpert. Und es war doch nicht immer bloße Liebedienerei, sondern oft genug der Ausdruck wirklicher Dankbarkeit gegen einzelne kaiserliche Wohltäter, verbunden mit der Sehnsucht nach unmittelbarer Nähe und sichtbarer Gegenwart des Göttlichen, was dem Kaiserkultus seine große Bedeutung im ganzen römischen Reiche verlieh. Ein Augustus, der den Gräueln des Bürgerkrieges ein Ende bereitet hatte, mochte immerhin als ein Friedensfürst, als der Retter in höchster Not erscheinen, der gekommen war, der Welt ein neues Aussehen zu verleihen und die schönen Tage des goldenen Zeitalters heraufzuführen. Er hatte der Menschheit wieder ein Ziel des Lebens, dem Dasein gleichsam wieder einen Sinn gegeben. Als das Oberhaupt der römischen Staatsreligion, eine Persönlichkeit, in der die Fäden der gesamten Weltpolitik zusammenliefen, als der Beherrscher eines Reiches, wie die Welt es bisher noch nicht gesehen hatte, konnte er recht wohl den Menschen als ein Gott, als der auf die Erde herabgekommene Jupiter selbst erscheinen, der unter den Menschen seine Wohnung aufgeschlagen hatte. “Nun endlich ist die Zeit vorbei,” heißt es in einer vor nicht langer Zeit gefundenen Inschrift zu Priene, vermutlich aus dem Jahre 9 v. Chr., “da man bedauern musste, geboren zu sein. Die Vorsehung, die über allem Leben waltet, hat diesen Mann uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt. Er wird aller Fehde ein Ende machen und alles herrlich ausgestalten. In seiner Erscheinung sind die Hoffnungen der Vorfahren erfüllt. Alle früheren Wohltäter der Menschheit hat er übertroffen. Es ist unmöglich, dass ein Größerer komme. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihn sich anknüpfenden Heilsbotschaften (“Evangelien”) heraufgeführt. Von seiner Geburt muss eine neue Zeitrechnung beginnen”. 5
…..