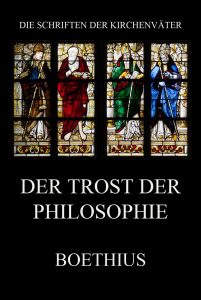Der Trost der Philosophie – Boethius
Boethius’ bekanntestes Werk ist der “Trost der Philosophie”, (oder “Tröstungen der Philosophie”), das er während seiner Gefangenschaft schrieb – “das bei weitem interessanteste Beispiel von Gefängnisliteratur, das die Welt je gesehen hat.” Es ist ein Dialog zwischen der Philosophie und Boethius, in dem die Königin der Wissenschaften versucht, den gefallenen Staatsmann zu trösten. Das Hauptargument des Diskurses ist die Vergänglichkeit und Unwirklichkeit aller irdischen Größe und das höhere Begehren nach den Dingen des Geistes. Es gibt offensichtliche Spuren des Einflusses der Neuplatoniker, besonders von Proklos, und wenig, das christliche Einflüsse widerspiegelt. Der Rückgriff auf den Stoizismus, insbesondere auf die Lehren von Seneca, war angesichts der Natur des Themas unvermeidlich. Es erstaunt den modernen Leser, obwohl es den mittelalterlichen Studenten seltsamerweise nicht überraschte, dass Boethius, ein Christ und, wie jeder im Mittelalter glaubte, ein Märtyrer, es versäumt haben sollte, sich in seinem Moment der Prüfung und der mentalen Erschöpfung auf die offensichtlichen christlichen Quellen des Trostes zu beziehen. Vielleicht verstand der mittelalterliche Schüler des Boethius besser als wir, dass ein streng formaler Dialog über den Trost der Philosophie sich strikt an den Bereich der “natürlichen Wahrheit” halten und die aus den moralischen Maximen des Christentums abzuleitende Lehre – die “übernatürliche Wahrheit” – außer Acht lassen sollte.
Format: eBook/Taschenbuch
Der Trost der Philosophie
ISBN eBook: 9783849659899
ISBN Taschenbuch: 9783849668259
Auszug aus dem Text:
Erstes Buch
I.
Der ich Gesänge vordem in blühendem Eifer vollendet,
Wehe, wie drängt das Geschick traurige Weisen mir auf.
Also schreiben mir vor voll Schmerz die verwundeten Musen,
Tränen von echtestem Leid haben ihr Antlitz genetzt.
Konnte sie doch allein der Schrecken nimmer besiegen,
Als Gefährten nur sie folgten allein meinem Pfad.
Was die Zierde einst war glückselig blühender Jugend,
Ist dem trauernden Greis Trost noch in Todesgefahr.
Unvermutet erschien vom Leide beschleunigt das Alter,
Jahre häufte der Schmerz auf das ermüdete Haupt.
Von dem Scheitel zu früh ergrauend wallen die Locken,
Schlaff erzittert und welk mir am Leibe die Haut.
Seliger Tod, der sich nicht drängt in die Freuden der Jugend,
Der dem Trauernden nur häufig gerufen erscheint.
Ach er wendet sein Ohr verschlossen dem Flehen der Armen,
Grausam weigert er stets Ruhe dem weinenden Aug’.
Schon da das wankende Glück noch flüchtige Güter gespendet,
Schien das Haupt mir versenkt fast in der Stunde der Angst.
Jetzt da es wolkenverhüllt das trügende Antlitz gewendet,
Da mir das Leben verhaßt, schleppt sich unselig die Zeit.
Warum prieset ihr einst mich oft so glücklich, o Freunde?
Wer so stürzte, der stand niemals auf sicherem Fuß.
Während ich solches schweigend bei mir selbst erwog und meine tränenvolle Klage mit Hilfe des Griffels aufzeichnete, schien es mir, als ob zu meinen Häupten ein Weib hinträte von ehrwürdigem Antlitz, mit funkelndem und über das gewöhnliche Vermögen der Menschen durchdringendem Auge, von leuchtender Farbe und unerschöpfter Jugendkraft, obwohl sie so bejahrt war, daß sie in keiner Weise unserem Zeitalter anzugehören schien. Ihr Wuchs war von wechselnder Größe; denn jetzt zog sie sich zum gewöhnlichen Maß der Menschen zusammen, jetzt aber schien sie mit dem Scheitel den Himmel zu berühren; und als sie noch höher ihr Haupt emporhob, ragte sie in den Himmel selbst hinein und entzog sich so dem Blick der Menschen. Ihr Gewand war von feinstem Gespinst und mit peinlicher Kunstfertigkeit aus unlösbarem Stoff gefertigt; sie hatte es, wie ich später aus ihrem eignen Munde erfuhr, mit eigner Hand gewebt. Seinen Glanz hatte wie bei rauchgeschwärzten Bildern ein trüber Anflug von Vernachlässigung und Alter überzogen. An seinem untersten Rande las man eingewebt ein griechisches (xxx), an seinem obersten aber ein (xxx). Und zwischen beiden Buchstaben schienen wie an einer Leiter etliche Stufen eingezeichnet, die von dem unteren zum oberen Schriftzug emporstiegen. Doch hatten dieses selbe Kleid die Hände einiger Gewalttätiger zerfetzt, und jeder hatte ein Stückchen nach Vermögen weggeschleppt. Ihre Rechte endlich trug Bücher, ihre Linke aber ein Szepter.
Als sie die Dichtermusen, die mein Lager umstanden und meiner Tränenflut Worte liehen, erblickte, sprach sie etwas erregt, entflammt mit finsteren Blicken: „Wer hat diesen Dirnen der Bühne den Zutritt zu diesem Kranken erlaubt, ihnen, die seinen Schmerz nicht nur mit keiner Arzenei lindern, sondern ihn obendrein mit süßem Gifte nähren möchten? Sind sie es doch, die mit dem unfruchtbaren Dorngestrüpp der Leidenschaften die fruchtreiche Saat der Vernunft ersticken, die der Menschen Seelen an die Krankheit gewöhnen, nicht sie davon befreien. Wenn eure Schmeichelreden einen Uneingeweihten, wie es gemeinhin durch euch geschieht, ablenken, so würde ich das für minder lästig halten. In diesem aber darf unser Werk nicht verletzt werden; denn er ist mit den Studien Eleas und der Akademie ernährt worden. Drum hinweg ihr Sirenen, die ihr süß seid bis zum Verderben, überlaßt ihn meinen Musen zur Pflege, zur Heilung.“
So gescholten senkte jener Chor tief bekümmert die Blicke, Erröten verriet ihre Scham, so gingen sie traurig über die Schwelle hinaus. Ich aber, dessen tränenüberströmtes Antlitz ein Nebel hüllte, so daß ich nicht unterscheiden konnte, wer diese Frau von so gebietender Würde sei, verstummte, heftete mein Auge auf die Erde und begann schweigend abzuwarten, was sie nun weiter tun werde. Da trat sie näher an mich heran, setzte sich auf das Ende meines Bettes, blickte auf mein tränenschweres, auf die Erde geneigtes Antlitz und klagte in folgenden Versen über die Verwirrung meines Geistes:
II.
Wehe wie sinkt zum Grund nieder die Seele;
Also erschlafft, vergißt eigenen Licht’s sie,
Sucht mit schwankendem Schritt draußen das Dunkel;
Und vom irdischen Hauch immer vermehret
Wächst bis zum Übermaß nagende Sorge.
Und einst war sie gewöhnt Räume des Himmels
Zu ätherischem Flug frei zu durchmessen,
Schaute das rosige Licht frühe der Sonne,
Blickt’ auf den frostigen Glanz spät noch des Mondes,
Wie der wandelnde Stern zieht seine Bahnen,
In verschlungenem Kreis wieder zurückkehrt,
Hatt’ er in Zahlen gefaßt, hier auch ein Sieger.
Forschte die Gründe er doch, welche das Brausen
Regeln des Sturms, der tiefaufwühlt die Meerflut,
Welch ein geistiger Hauch umdreht den Erdkreis,
Was das Abendgestirn senkt in des Westens
Meereswogen und früh rötlich im Ost hebt,
Was die Tage im Lenz angenehm mildert,
Daß die Erde sich schmückt rosig mit Blüten,
Wer es macht, daß der Herbst schwanger von Früchten
Überfließt, bis zuletzt schwellend von Trauben.
Alles hat er erforscht, bis zur verborgnen,
Wechselreichen Natur Gründe gelangt er!
Und nun ist ihm des Geist’s Leuchte erloschen,
Und den Nacken im Druck engender Ketten
Zwingt die wuchtende Last nieder den Blick ihm,
Wehe nur dich zu schau’n, törichte Erde!
…