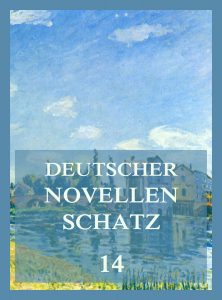Deutscher Novellenschatz, Band 14
Der “Deutsche Novellenschatz” ist eine Sammlung der wichtigsten deutschen Novellen, die Paul Heyse und Hermann Kurz in den 1870er Jahren erwählt und verlegt haben, und die in vielerlei Auflagen in insgesamt 24 Bänden erschien. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden in dieser Edition die sehr alten Texte insofern überarbeitet, dass ein Großteil der Worte und Begriffe der heute gültigen Rechtschreibung entspricht. Dies ist Band 14 von 24. Enthalten sind die Novellen: Kopisch, August: Der Träumer. Lewald, Fanny: Die Tante. Wichert, Ernst: Ansas und Grita.
Format: eBook/Taschenbuch
Deutscher Novellenschatz, Band 14.
ISBN eBook: 9783849661229
ISBN Taschenbuch: 9783849666767
Auszug aus dem Text:
Von dem Strande, welcher nun Stabiä, die fast zweitausend Jahre in Aschenregen begrabene Stadt, lieblich überblüht, gelagert zwischen dem Golf von Neapel und dem von Salerno, erhebt sich über den Spiegel des anmutigen Meeres, erst mit sanfteren Hügeln, bald aber geschwungener und kühner, ein mächtiges, vielzackiges, oben dunkel bewaldetes Kalkgebirge, dessen fruchtbare, terrassierte Hänge der Bienenfleiß der Menschen überall reichlich mit Öl- und Weingärten und mit unzähligen zierlichen Ortschaften überbaut und geschmückt hat. So vollendet ist daselbst das Werk des Fleißes, dass es vor die Augen tritt wie ein müheloses, unmittelbar göttliches Geschenk, als habe das Paradies sich herniedergesenkt in die Täler und um die Lehnen der zackigen Anhöhen.
Unter den vielen Ortschaften aber erhebt sich eine, Gragnano genannt, besonders gesegnet mit köstlichen Purpurtrauben. So reichlich trägt die Rebe dort, dass die Winzer noch im Schatten gehen, wenn sie schon die Blätter hinweggebrochen: die Trauben allein geben Schatten genug. Nicht zu früh, nicht zu spät reifen sie dort an den luftigen Hängen und füllen die gewaltigen Fässer mit köstlichem Getränk, so dass die Besitzer daselbst von Jahr zu Jahr an Wohlhabenheit zunehmen. Ja, rings um den ganzen schönen Golf sagt man, will man jemanden als wohlhabend bezeichnen: Er hat sein Kellerchen in Gragnano.
Nun hatte daselbst vor Jahren Gott einem Mann namens Strintillo solcher Kellerchen nicht nur eines, sondern mehrere beschieden, auf deren Besitz sich Herr Strintillo nicht wenig zugutetat. Seine liebste Rede war: Ich bin Don Strintillo, und was ich haben will, muss geschehen! – Herr Strintillo wollte jedoch manchmal sehr dummes Zeug; besonders wenn ihm dergleichen geträumt hatte, denn er war über alle Maßen abergläubig und hielt gewaltig viel auf seine Träume. So hieß er einst in eine dürre Felszacke einen Brunnen hauen, weil ihm dort im Traum von seinem Vetter Ciccio ein Glas Wasser gereicht worden. Als man ihm aber vorstellte: Hier werde kein Wasser kommen, sprach er: Ich bin Don Strintillo, und was ich haben will, muss geschehen! – Sofort wurde mit dem Hauen des Brunnens begonnen. Man sprengte, dass die Steine flogen. Drei Monate vergingen – immer kam noch kein Wasser; aber Don Strintillo verlor den Mut nicht und würde, jedem Spötter zum Trotz, noch heute graben lassen, hätte sein Vetter Ciccio nicht Wasser in die Grube gegossen und ihm ein Glas daraus geschöpft und zu trinken gereicht. – Wer hat nun recht? fragte Don Strintillo und trank das Glas rein aus. Zwar kam später, trotz alles Grabens, kein Wasser mehr nach; aber Don Strintillo hielt den Traum für erfüllt und war zufrieden, und als man ihm einige Zeit nachher von Ciccios List sagte, sprach er: So sagt ihr nur, damit ich nicht recht haben soll, und alles endigte damit, dass er nur desto mehr im Glauben an seine Träume bestärkt wurde, recht nach dem alten Sprichwort: Zerstoße den Narren im Mörser, und er wird ein Narr bleiben nach wie vor. Jeden Morgen, sogleich nach dem Frühgebet, langte Don Strintillo nach seinen Traumbüchern, deren er nicht genug bekommen konnte. Dieselben widersprachen sich zwar hie und da; aber das war ihm eben recht; denn traf sein Traum nach dem einen Buche nicht ein, so fand er in dem anderen Trost. Alles, was ihm widerfuhr, wusste er immer hinterher den Träumen anzupassen, die er kurz vorher oder lange vorher gehabt hatte. Als ihm seine gute Frau starb, sagte er zu seinem Vetter Ciccio mit Tränen in den Augen: Da sieh, wie meine Träume zuletzt doch eintreffen! – Vor drei Jahren, just in derselben Nacht, sah ich im Traum eine Katze, die auf glühenden Kohlen stand und gewaltig schrie. Was diese Katze bedeuten sollte, konnte ich damals in meinen Büchern nicht finden und auch nicht denken; nun ist es aber klar: Die Katze, die auf Kohlen sieht, ist meine Frau im Fegefeuer; denn unter uns gesagt, sie kam mir manchmal nicht aufrichtig vor. Nun aber lass uns für ihre arme Seele beten.
Ihr tut ihr Unrecht, sagte Don Ciccio.
Lass uns beten, sagte Strintillo, vor Gott sind wir alle Sünder!
Zum Glück wurde seine schöne Tochter Angiolina nicht von ihm erzogen, sondern von einer verständigen Muhme, die er ins Haus genommen, und wuchs an Seel’ und Leib so herrlich heran, dass sie mit sechzehn Jahren das Wunder der ganzen Gegend war. Unzählige Freier hatten sich bereits vergeblich bei dem wunderlichen Vater um sie beworben, als eines Tages zwei bei ihm zusammentrafen, welche sich besser berechtigt glaubten als alle früheren. Der ältere dieser Freier, Don Granco, war zwar von Gestalt hässlicher und drolliger, als man irgendein Figürchen aus Brot kneten könnte, dabei jedoch der wohlhabendste Mann in Gragnano und, was ihn bei Strintillo gleichermaßen empfahl, wie er, ein leidenschaftlicher Liebhaber von Träumen. Der andere dieser Freier aber war das Gegenteil von diesem, weder ein Träumer noch mit Reichtümern gesegnet, aber sonst mit allem ausgestattet, was an jungen Leuten wohlgefällt. Er war jung und schön, kräftig und rührig und rasch in allem, was er tat, der beste Tänzer am Ort und geliebt von Jung und Alt. Begabt mit der süßesten Stimme, die je von Mannesmund erklungen, verstand er zu Tänzen und Spielen augenblicklich die zierlichsten Weisen und Lieder zu erfinden, und hatte vor kurzem erst in einem Wettsingen mit den besten Improvisatoren der Umgegend eine schön ausgelegte Mandoline gewonnen, zu deren beseelten Klängen er unter Angiolines Fenster manch schmelzendes Lied gehaucht. Kurz, Don Granco besaß das Herz des Vaters und Giovanni das Herz der Tochter, und war bei dem Alten ebenfalls so wohl angeschrieben, dass er die beste Hoffnung hatte. So gerüstet traten beide zugleich in das Zimmer; jeder im Vertrauen auf sein Glück, hatte keiner ein Hehl vor dem anderen, und Giovanni ließ den drolligen Don Granco seine Werbung zuerst anbringen. Dieser hub folgendermaßen an: Mein ehrenwerter Freund Strintillo, vielleicht ist Euch bereits bemerklich geworden, wie mich schon seit geraumer Zeit der Liebesgott quält und peinigt, und zwar um Eurer schönen Tochter willen, welche, wie alle Welt weiß, von der Nasenspitze bis zur kleinen Zehe nichts andres ist als ein Zucker und ein Honig, und, dass ich es kurz heraussage, durchaus gemacht für Euren Diener Granco. Viel Redens kann ich nicht machen, gebt sie mir zum Weibe: Ich stelle sie in ein Glasschränkchen und lasse kein Stäubchen auf sie fallen; so wahr ich Granco bin, es soll Euch nicht leid werden! – Ihr wundert Euch vielleicht, woher ich den Mut nehme, und sogar auf einmal mit der Tür ins Haus falle? Doch seht diese zerknitterte Schlafmütze hier und vernehmt, was mir diese Nacht geträumt hat.
Bei diesen Worten ward der arme Giovanni leichenblass. Auf einen Traum seines Nebenbuhlers war er nicht gefasst, und da er Strintillos Leidenschaft für Träume kannte, fürchtete er sehr, dass Granco die Oberhand gewinnen könnte.
Der Traum ist, fuhr Granco fort, so gut wie einer sein kann, und ein Morgentraum, er passt überall ein und schließt zusammen, dass gar keine Fuge bleibt. Hierauf erzählte Granco mit langweiliger Ausführlichkeit: Wie ihm Angiolinchen im Traum erschienen sei, um und um mit Blumen besteckt, und ihm eine Rose gegeben habe; wie sie dann zusammen einen großen goldenen Fisch gefangen und mit einem Hammer totgeschlagen hätten; der Fisch aber habe so viel Rogen gehabt, dass alle seine Kessel und Töpfe nicht langen wollten, ihn aufzunehmen. Als er deshalb den Hut abgenommen, sich hinter den Ohren zu kratzen, sei er aufgewacht, die Schlafmütze in der Hand, die er vor Freuden über den prächtigen Traum ganz zerküsst und zerbalgt habe. Da seht, wie sie aussieht, überall zerknittert und zerknüllt!
Warum aber dünkt Euch der Traum so gut? fragte Giovanni. Da sagte Don Granco: Wenn Ihr es ihm nicht selber ansehet, will ich Euch belehren; der Traum ist sechsmal gut:
Einmal, weil der Gegenstand der Liebe selber darin ist.
Zweitens, bedeuten die Blumen, dass das Zuckerkind bald heiraten wird.
Drittens, bedeutet die Rose, die sie mir gab, dass ich ein beneideter Mann sein werde.
Viertens, bedeutet das Angeln und dass der Fisch anbeißt, unsere Heirat, und dass wir immer wohlhabend sein werden, denn der Fisch war von Golde.
Fünftens, bedeutet der Hammer, dass wir die Heirat durchsetzen werden, es mag in die Quer kommen, wer da will, und endlich:
Sechstens, bedeutet der viele Rogen zahlreichen Kindersegen.
Nun sagt selber, was fehlt dem Traum noch an seiner Vollkommenheit? Fragt einmal Don Strintillo, er ist gelehrter als ich; aber er mag ihn nach Rotbarts Traumbuch auslegen oder nach Schwarzbarts, er ist gut und bleibt gut. Nach der klugen Sibylle fällt er freilich anders, aber da sind die Nummern verdruckt, und wer ihr traut, ist immer betrogen. Was meint Ihr, Don Strintillo, fragte Granco mit zuversichtlicher Miene, ist er nicht gut, ist er nicht prächtig?
Aber Strintillo, der auf keine Frage rasch zu antworten gewohnt war, und der, unter uns gesagt, noch etwas auf die Sibylle hielt, bewegte nachdenklich den Kopf, wandte sich zu Giovanni, und fragte: Hat Euch auch etwas geträumt? –
Mir? Nein – oder doch, ja, entgegnete Giovanni, und ergriff die Hand Strintillos: Mein lieber Don Strintillo, seit ich Eure Tochter gesehen, lebe ich beständig, Tag und Nacht, in dem Traume fort, dass nie Leute glücklicher zusammenleben würden als Eure Tochter und ich! Hierbei standen ihm die hellen Tränen in den Augen. Don Strintillo sah ihn freundlich an und sagte: Nun, mein lieber Giovanni, ich weiß, dass meine Tochter Euch wohl will, und habe nichts gegen Euren wachenden Traum und gegen Euren schlafenden auch nichts, ehrenwerter Don Granco. Beide Träume können recht gut sein, doch erstens, habe ich sie nicht selber geträumt, und zweitens seid ihr an einem bösen Tage zu mir gekommen, denn hört: Als ich diesen Morgen ausgehen will, kommt mir rechts ein altes Weib entgegen, links huscht mir ein Häschen über den Weg, und wie ich wieder ins Haus trete, läuft mir, bis ins Zimmer, Ciccios roter Hund nach, der mir nie Gutes bringt. Daher ist der heutige Tag sehr böse, und gar nicht gemacht, um dergleichen zu beschließen, geduldet euch also noch heute, morgen früh sollt ihr ausführlichen Bescheid haben. Keiner von euch wird darum von mir verachtet; aber ich will die Sache beschlafen. Der Himmel wird mir einen Wink geben, dem ich folgen kann. Das Schicksal meines einzigen Kindes liegt mir zu sehr am Herzen, als dass ich dergleichen ohne himmlischen Rat beschließen könnte. Lebt wohl. Heute drohet Unglück in meinem Hause, darum wird euch weder Speise noch Trank gereicht. Ein andermal sollt ihr mir herzlich willkommen sein.
Mit solchen Reden entließ Don Strintillo für diesen Tag die beiden Freier. Don Granco fand alles sehr natürlich und blieb, im Vertrauen auf seinen sechsmal vortrefflichen Traum, so glücklich als vorher. Aber Giovanni geriet, als er das Haus verlassen, über den abergläubischen Strintillo ganz außer sich, und als er ins Freie kam, rief er zum blauen Himmel empor: Wenn das Schicksal eines Wesens wie Angiolina an Strintillos albernen Träumen hängt, was soll aus ihr, was soll aus mir werden! Lieber himmlischer Vater, erhelle doch die Augen des Alten, dass er die Tochter nicht auf ewig unglücklich macht, tue seinen Sinn auf über seine Torheiten, oder willst du ihn nicht umschaffen, sende ihm wenigstens einen Traum, worin Angiolina ihm um den Hals fällt und ihn bittet, mich zu nehmen; oder wie du sonst seinen Willen lenken willst, denn du vermagst ja alles und jedes, wie deine Weisheit es für gut findet. – Dieser letzte Gedanke machte Giovanni etwas ruhiger. Langsam schlich er zurück unter Angiolines Fenster und flüsterte die traurige Botschaft hinauf. Angiolinchen, obwohl selbst erschrocken, suchte seine Sorgen zu beschwichtigen, und sagte zu ihm: Lieber Giovanni, tröste dich, mein Vater hat dich lieb, wir wollen Gutes hoffen, gehe nach deinem Weinberge und zerstreue dich mit Arbeiten. Geh, ich will auch etwas vornehmen, so wird Sorge und Unruhe am besten bekämpft. Langsam ging Giovanni nach seiner kleinen Besitzung. Sie schien ihm heute kleiner als je, weil er sie mit Grancos Gütern verglich. Er ging an die Arbeit und kämpfte mit Gewalt gegen seine Sorgen, aber er war immer noch in einem Zustande, der einem Fieber glich. Der Mond schien lieblich und klar, es trieb ihn nach dem Hause seiner Geliebten, er nahm seine Mandoline mit und spielte unter ihrem Fenster alle Lieblingsweisen; aber wenn er an den anderen Morgen gedachte, sanken ihm die Hände von den Saiten. Geh zur Ruh’, lieber Giovanni! bat Angiolina mit süßem Flüstern mehrere Male flehentlich. Er ging auch, kam aber immer wieder zurück, und um Mitternacht sang er unter dem Fenster der Kleinen, die selbst nicht tat, was sie ihn hieß, folgendes Lied aus seinem Herzen, während der Vesuv dazu leuchtende Gluten in die Mondnacht emporwarf:
…