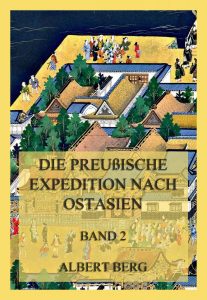Die preußische Expedition nach Ostasien, Band 2 – Albert Berg
Die preußische Ostasien-Expedition, auch als “Eulenburg-Expedition” bekannt, war eine diplomatische Mission, die Friedrich Albrecht zu Eulenburg im Auftrag Preußens und des Deutschen Zollvereins in den Jahren 1859-1862 durchführte. Ihr Ziel war es, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu China, Japan und dem damaligen Siam aufzubauen. Die wichtigsten Teilnehmer der Expedition waren Friedrich Albrecht zu Eulenburg, Lucius von Ballhausen (Arzt), Max von Brandt (Attaché), Wilhelm Heine (Maler), Albert Berg (Künstler), Karl Eduard Heusner, Fritz von Hollmann, Werner von Reinhold, Ferdinand von Richthofen und Gustav Spiess. Der Expedition standen drei Kriegsschiffe des preußischen Ostasiengeschwaders zur Verfügung, die SMS Arcona, die SMS Thetis und die SMS Frauenlob. Dies ist Band zwei von vier der Aufzeichnungen zu dieser Expedition. Der Text folgt den Originalausgaben, die zwischen 1864 und 1873 erschienen, wurde aber in wichtigen Wörtern und Begriffen der heute aktuellen Rechtschreibung angepasst.
Format: Paperback, eBook
Die preußische Expedition nach Ostasien, Band 2.
ISBN: 9783849666132 (Paperback)
ISBN: 9783849662165 (eBook)
Auszug aus dem Text:
VI. TOKIO.
VOM 2. OKTOBER BIS 1. NOVEMBER 1860.
Der Oktober, sonst in Japan der schönste Monat, brachte in seiner ersten Woche heftigen Regen. Als der Himmel am Morgen des 7. sich aufklärte, beschloss der Gesandte den längst beabsichtigten Ausflug nach Kanagava auszuführen; wir stiegen gegen zehn zu Pferde und ritten, geleitet von Heusken und gefolgt von mehreren Yakuninen, dem Tokaïdo zu. Der Weg führt durch die endlosen Häuserreihen von Sinagava und Omagava, dann zwischen Hecken und ländlichen Wohnungen hin, und endlich in das Freie. Streckenweise ist die Landstraße mit Reihen von Kryptomerien gesäumt; zu beiden Seiten liegen Reisfelder, links vom Meere, rechts von grünen Hügelreihen begrenzt; grade aus, über die zackigen Fakone-Berge ragend, der Fujiyama. Bei trefflicher Anlage auf breitem Damm ist die ganze Strecke bis Kanagava auffallend vernachlässigt, während in anderen Landesteilen die Verkehrsstraßen den Vergleich mit guten europäischen aushalten sollen. — Halbwegs Kanagava überschreitet man auf Fähren das Flüsschen Logan, die vertragsmäßige Nordgrenze des freien Verkehrs für die fremden Ansiedler in Kanagava und Yokohama; drüben empfangen den Reisenden wieder die geschlossenen Häuserreihen des Dorfes Kawasaki, das sich ohne Unterbrechung in mehrere andere fortsetzt; man glaubt durch eine große Stadt zu reiten. Wo der Blick endlich wieder Raum gewinnt, beherrscht er links das Meer; rechts tritt ein grüner Höhenzug immer näher an die Straße. Bald künden zerstreute Gehöfte und Bauernhäuser die Nähe von Kanagava an; ihre Strohdächer tragen auf der First eine auffallende Bekrönung hellgrüner Irispflanzen, die, einmal gesät, sich immer wieder erzeugen, und durch ihr Wurzelgewebe der Dachfirst große Festigkeit gegen Wind und Wetter verleihen. — Dann werden die Häuser städtischer. Der Raum zwischen dem Meer und der steil abfallenden Höhe verengt sich zu einem schmalen Streifen, den ein Labyrinth gewundener Gassen und Gässchen erfüllt. Auf der Höhe rechts und an ihrem Abhange liegen Tempel und andere ansehnliche Gebäude, die Wohnungen der Konsuln; schwindelnde Treppenfluchten führen bis zum Gipfel hinan. — Der Gesandte stieg bei Herrn von Bellecourt ab, der grade in Geschäften anwesend war; seine Begleiter fanden im englischen und im portugiesischen Konsulat gastliche Aufnahme. Die Yakunine wurden entlassen, denn hier durfte man sich ohne Eskorte bewegen.
Kanagava bietet außer seiner schönen Lage und dem Blick von den Höhen auf die freundliche belebte Bucht kaum etwas Bemerkenswertes; Einige von uns fuhren noch denselben Nachmittag nach Yokohama hinüber zu ihren dort wohnenden Reisegefährten. Die Bootsfahrt dauert bei gutem Wetter kaum eine halbe Stunde; der Fujiyama, der uns an diesem Tage zuerst im weißen Winterkleide erschien, spiegelte majestätisch sein glänzendes Haupt in dem weiten Becken.
Wir fanden unsere Freunde in dem damals in Entstehung begriffenen Yokohama-Hotel, — das ein gewesener holländischer Schiffskapitän baute, — zwar nicht sehr bequem eingerichtet, aber zufrieden mit ihrem Aufenthalt. Das Vordergebäude des Gasthofes wurde eben in Angriff genommen und noch im Laufe des Winters vollendet; der geräumige Hof, an drei Seiten von langen einstöckigen Baracken umschlossen, lag voll Baumaterial; auf der einen Seite der Speisesaal mit Billard und Schankzimmer, gegenüber eine Reihe kleiner Wohn- und Schlafstuben, im Grunde, dem Hauptgebäude gegenüber, die Pferdeställe, Alles in Eile budenartig zusammengezimmert und halb japanisch, halb europäisch eingerichtet. Das Ganze glich damals einer improvisierten Jahrmarktsschenke; aber Küche und Keller waren gut, der Wirt zuverlässig und gefällig, und für Bedienung sorgte man selbst. Yokohama, zwei Jahre vorher noch ein elendes Fischerdorf, blühte mächtig auf, und, war auch die goldene Zeit der Kobang-Ausfuhr vorüber, so wurden doch täglich noch bedeutende Summen gewonnen. Alle großen westländischen Handelshäuser Chinas hatten dort ihre Kommanditen und setzten große Massen baren Silbers in Umlauf; die Waren-Ausfuhr blieb immer hinter der Nachfrage zurück. Japanische, europäische und amerikanische Kaufleute, Handwerker und Abenteurer strömten in Menge zu, um voneinander Vorteil zu ziehen und den Markt auszubeuten, ein reges schwindliges Treiben.
Den Mittelpunkt des kleinen Verkehrs bildete eine lange gerade Straße, mit Krambuden und Kaufläden Haus für Haus, wo man die größte Auswahl von Lack- und Bronze-Waren und alle die tausenderlei Kleinigkeiten findet, deren schon bei der Beschreibung von Tokio gedacht wurde. Die meisten Sachen aber sind von geringer Qualität, außen glatt und glänzend, doch wenig dauerhaft, dabei wohlfeiler als in Tokio und großenteils auf das Bedürfnis und den Geldbeutel der Schiffsmannschaften berechnet. Das fremde Publicum ist hier ja auch viel zahlreicher und weniger wählerisch als in der Hauptstadt; die meisten kaufen aus Spekulation, nicht aus Liebhaberei, daher denn auch der europäische Markt mit mittelmäßigen japanischen Fabrikaten überschwemmt ist, die im Lande selbst keinen Absatz finden würden, während die besseren, namentlich alte Lac- kund Bronzewaren, welche in Japan hohe Preise haben, verhältnismäßig selten zu uns gelangen. Einzelne wertvolle Stücke kommen auch in Yokohama vor und finden an den wenigen Liebhabern unter den Konsuln und gebildeteren Kaufleuten bereitwillige Käufer. Die japanischen Krämer wissen ihr Publicum sehr wohl zu beurteilen, und hüten sich kostbare Sachen in den offenen Läden der Kritik und Betastung des Schiffsvolkes preiszugeben; in den Hinterzimmern aber kramen sie bereitwillig ihre Schätze aus, oder bringen guten Kunden auch wohl die wertvollsten Sachen in die Häuser.
Am Ende der langen Straße lag eine kleine Menagerie, richtiger Tierhandlung, in der für die Eingeborenen ein europäisches Schaaf und ein Kakadu das Merkwürdigste waren, für uns dagegen die weißen Kraniche und japanischen Affen, welche nur in den südlichen Teilen des Reiches vorkommen. Der Zoologe der Expedition Dr. von Martens tat dort und auf dem Fischmarkt, wie der Botaniker Regierungsrat Wichura bei den Kunstgärtnern und Samenhändlern manchen erwünschten Fund. Beide Naturforscher und auch der Geologe Freiherr von Richthofen waren mit ihrem Aufenthalte in Yokohama sehr zufrieden; sie konnten sich hier frei bewegen und machten weite Ausflüge in die Umgegend. Überall nahmen die Landleute sie freundlich auf, bewirteten sie gern mit Tee, Eiern und Apfelsinen, und waren oft erstaunt einige Tempo — Groschen — dafür zu erhalten. Sie zeigten sich niemals misstrauisch oder zudringlich, gingen oft, dienstfertig und bescheiden, weite Strecken mit um den Weg zu zeigen, oder beauftragten damit ihre Kinder. Kleine Knaben und Mädchen liefen, wo ein Fremder sie zufällig in Busch oder Feld allein überraschte, wohl schreiend davon, wurden aber bei näherer Bekanntschaft leicht freundlich und vertraulich; sie waren in Schwärmen höchstens durch unaufhörliches Zurufen des Grußes »Anata oheio«, durch neugieriges Andrängen und starres Begaffen, niemals aber durch absichtliche Unarten und Possen lästig, wie in anderen Ländern nur zu häufig. Die Naturforscher fanden in dem Verkehr mit dem einfachen unbefangenen Landvolk geradezu eine Lebensannehmlichkeit, und besuchten manches stille Tal, wohin niemals Fremde gedrungen waren. Dann war ihre Tuchkleidung immer Gegenstand der größten Bewunderung und wurde unter vielen Fragen von allen Seiten betastet. Dass man sie weder verstand noch antworten konnte begriffen die Meisten gar nicht; man schien das Japanische für die natürliche Sprache des Menschengeschlechtes zu halten, und nicht zu ahnen, dass es noch andere gäbe. — Sowohl der Botaniker als der Zoologe ließen sich auf diesen Wanderungen häufig durch ihre japanischen Diener begleiten, deren Treue und Anhänglichkeit sie nicht genug zu rühmen wussten; beide lernten ihren Herren bald ab worauf es ankam, und bewiesen, durchdrungen von der Wichtigkeit ihres Amtes, den größten Eifer in Herbeischaffung und Präparierung der Naturalien.
Die sumpfige Niederung von Yokohama ist von Hügelland umgeben, das sich an der Südseite des Städtchens in steilen Tonmergelwänden in das Meer hinausschiebt; — die Fremden nennen das Vorgebirge »Mandarin-Bluff«. Hier liegt in einer nach Norden sich öffnenden Schlucht das Denkmal der ermordeten Russen. Viele Täler und Tälchen, deren flacher Boden, wie bei Tokio, mit Reis bebaut und künstlich bewässert ist, durchfurchen die niedrigen, meist mit Pinus Massoniana bestandenen Höhen. Am oberen Ende der Senkung liegt gewöhnlich im Waldesdickicht ein Teich, zahlreich bewohnt von Fischen, Wassersalamandern und Libellen, wo die von den Hängen abfließenden Gewässer sich sammeln, um nach Bedürfnis auf die Felder abgelassen zu werden. Hier und da sind kleine Hochebenen mit Rüben und Gerste, Weizen, Bohnen, Buchweizen, Bataten, Hibiskus, mit Moorhirse und Baumwolle bestellt. Bauernhütten trifft man überall, und mitten im Walde stattliche Tempel, deren Priester dem Wanderer oft nicht ganz uneigennützig eine Schale abscheulichen Saki anbieten. Einen ähnlichen Charakter hat die Landschaft um Kanagava sowohl als die Küste nordöstlich von Yokohama.
Die Südosthälfte des Städtchens hatten damals die Ausländer, den nordwestlichen Teil die Japaner inne. Das den Fremden zugestandene Terrain reichte bald nicht mehr aus; die Repräsentanten der Vertragsmächte bemühten sich deshalb beständig um die weitere Abtretung von Grundstücken, und die Japaner wurden immer mehr aus Yokohama verdrängt. Man arbeitete fleißig an dem breiten Kanale, welcher die Niederlassung nach Art von Desima zur Insel machen sollte; jetzt umschließt er das Städtchen vollständig, so dass aller Verkehr von den japanischen Behörden kontrolliert werden kann. Der Weg nach Kanagava führt zunächst auf einem künstlich aufgeschütteten Damm zwischen Sumpf und See hin, und auf zwei gut gebauten Brücken über Einschnitte des Meeres. Hier und an anderen Stellen der Straße hat die japanische Regierung Wachthäuser und Tore angelegt, die bei eintretender Dunkelheit geschlossen und den Europäern oft erst nach langem Parlamentieren geöffnet werden. Es ist fast wie auf Desima, denn natürlich steht auch der Verkehr der Japaner mit Yokohama unter Aufsicht der Polizei, welche oft Menschen und Waren, ja Lebensmittel ganz nach ihrem Belieben ausschließt. Die in den Verträgen stipulierte Freiheit des Handelsverkehres besteht also in Wahrheit nicht und wird sich auch schwer durchsetzen lassen, denn die Autorität der Regierung über ihre Untertanen ist unbegrenzt, und die Behörden üben die strengste Aufsicht über den Großhandel. Die Anfuhr der Waren in Yokohama richtet sich ganz nach den Fluktuationen der politischen Lage. Jetzt, nachdem einige Jahre vergangen, lässt sich die Situation viel deutlicher übersehen als zur Zeit unserer Anwesenheit. Die im einleitenden Abschnitt ausgesprochene Ansicht, dass in den letzten Jahrzehnten die Regierung der Taïkūn die Zügel schießen lassen und an Macht und Ansehen verloren habe, dass einzelne Daïmios selbständiger geworden seien und sich leicht einmal wieder um den alten Thron des Mikado scharen könnten um das Haus Minamoto zu stürzen, hat sich bestätigt. Die höchste Würde des Mikado scheint heute ebenso anerkannt zu sein als vor tausend Jahren. Eine mächtige Adelspartei hat, die mit den westlichen Nationen vom Taïkūn eigenmächtig geschlossenen Verträge zum Vorwand nehmend, die Autorität des Erbkaisers angerufen und, ganz wie vor dreihundert, vierhundert, sechshundert Jahren, sich wiederholt seiner Person zu bemächtigen gesucht. Die Dynastie der Minamoto kämpft einen ernsten Kampf um ihre Existenz und hat sich zu Demütigungen vor dem Mikado verstehen müssen, wie sie seit Jahrhunderten unerhört waren. Sie braucht dessen Autorität vor dem Volke, um das Staatsruder in Händen zu behalten, die Verträge mit den Fremden sind ihr nur eine sekundäre Frage; die Regierung des Taïkūn ist offenbar sich selbst nicht klar, ob sie ihre Herrschaft besser durch Vertreibung der Ausländer oder durch Aufrechthaltung der Verträge sichern könne. Von beiden Seiten ist die Gefahr groß, daher die beständigen Schwankungen. Die Vertreter der westlichen Mächte haben in den letzten Jahren dem Gorodžio wiederholt ihre tätige Hilfe zur Unterdrückung der rebellischen Fürsten angeboten; aber ein solches Bündnis schien den Ministern wegen des nationalen Stolzes der Japaner immer zu gefährlich, und würde in der Tat wahrscheinlich das Volk auf die Seite des Feindes bringen. Man hat daher gegen jeden selbständigen Angriff der Fremden auf die rebellischen Fürsten immer laut protestiert, solchen aber stets gern gesehen und im Stillen unterstützt. Es ist ein beständiges Lavieren. Zu Zeiten ging die Regierung so weit, den fremden Vertretern öffentlich die Verträge zu kündigen und die Räumung von Yokohama zu verlangen, bezeichnete aber zugleich im Vertrauen diese Maßregel als eine bloße Form, die nur zur Erhaltung des guten Einverständnisses mit dem Mikado notwendig sei. Dann wieder, wenn es unmöglich schien sich auf diese Weise zu halten, wurde die Räumung von Yokohama allen Ernstes verlangt, die Lebensmittel abgeschnitten und eines schönen Tages alle Japaner aus der Niederlassung entfernt. In solchen Fällen brachte das kategorische Auftreten der fremden Vertreter und Geschwader-Kommandanten die japanischen Behörden meist bald zur Besinnung und Herstellung des alten Verhältnisses. In Wahrheit scheint die Regierung von Tokio den Ausländern im Prinzip weder feindlich noch besonders geneigt zu sein. Die Verträge sind ihr abgedrungen worden; sie wird dieselben gern erfüllen, wenn sie dadurch ihre Macht im Innern erhöht und befestigt, und wird sie brechen, wenn sie durch die Erfüllung ihre Existenz stärker gefährdet sieht als durch die Eventualität eines äußeren Krieges. Wäre eine sichere Gewährleistung ihrer Herrschaft durch die Fremden möglich, so würden die Minamoto und ihre Partei wahrscheinlich sofort deren aufrichtige Freunde. Einstweilen benutzen sie dieselben eifrig um durch Verbesserung ihres Kriegsmaterials den Rebellen überlegen zu werden.
…